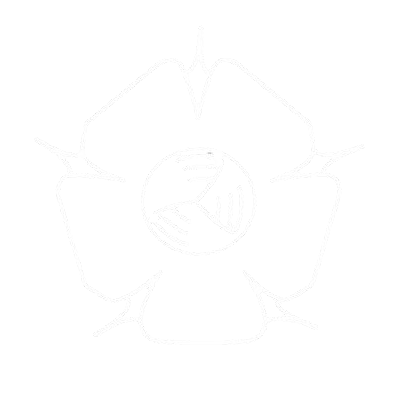Früh am Morgen steigen wir in den Laster ein. Es riecht nach Diesel und Zigarettenqualm. In meinem Magen rumort es leicht. Ich bin doch aufgeregt, das muss ich gestehen. Schließlich ist es mein erstes längeres Fernbleiben von der geliebten Heimat. Meine Reise soll mich in eine Gegend führen, die ich sonst nur aus Büchern und Artikeln, aus Hörensagen und Zeugenberichten kenne.
Ich schaue mich um. Zehn Soldaten haben sich wie Hennen auf den engen Bänken versammelt. Alles junge Kerle – kaum älter als zwanzig Jahre. Blasse Gesichter von Jungspunden. Sie lächeln, scherzen, spaßen, tauschen sich Zigaretten und Feuerzeuge aus. Einer erzählt, wie sehr er sich schon freut, dass es endlich losgeht. Wochenlang hätte er in der Kaserne ausharren müssen, während seine Freunde bereits alle »unten« sind.
Es ist warm und eng, Beinfreiheit ist nicht gegeben, ansonsten stößt man mit dem gegenübersitzenden Nachbarn zusammen. Ein älterer Offizier im feldgrauen Mantel steigt hinzu. Ein wohlgeformter Schnurrbart ziert sein leicht faltiges Gesicht. Er lächelt, man sieht seine makellosen weißen Zähne hervorblitzen. Ich frage mich, wie er das bei dem Zigarettenkonsum schafft. Er klopft mir freundschaftlich auf die Schulter. Der Herr ist mein Verbindungsmann.
»Gut Sie dabei zu haben, mein Junge. Es wärmt mir richtig das Herz, dass wir unsere Arbeit den restlichen Landsleuten präsentieren können. Die meisten Journalisten trauen sich nicht. Sie wollen sich die Drecksarbeit nicht angucken. Oh, sie schwärmen von unseren Errungenschaften, von unseren Erfolgen, aber Zeugen sein? – Nein, nein, lieber nicht. Könnte ja was passieren. Da könnte ja die Hose oder der Anzug schmutzig werden.« Er lacht. »Oder die weiße Weste – nicht wahr, Jungs?« Das erntet Gelächter von den anderen Soldaten.
»Das ist Ihr erstes Mal, oder? Sie waren vorher nicht unten, nicht wahr?«
»Das ist richtig«, antworte ich.
»Sehr schön, da können Sie sich auf was gefasst machen. Malerische Gegend, wirklich schön, nicht so wie das karge, flache Brandenburg oder das sumpfige Mecklenburg – nur schade, um den Menschenschlag der dort haust. Aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Vielleicht ziehe ich dann, wenn alles vorbei ist, dort hin. Bau mir einen kleinen Hof auf. War schon immer mein Traum. Muss nur noch die Frau überzeugen. Obwohl ich auch gerne in Brandenburg lebe, bin ja gebürtiger Brandenburger und auch sehr stolz darauf, aber ab und an braucht es einen Tapetenwechsel, nicht wahr? Sagen Sie, wo kommen Sie denn her?« Während er mich das fragt, springt der Motor des Lasters an. Ein ohrenbetäubendes Geräusch. Der Geruch von Diesel verstärkt sich. Ich muss lauter reden, damit mein Gegenüber mich hört. Wir setzen uns in Bewegung.
»Aus Königsberg, mein Herr.«
Der Offizier lächelt und winkt ab. »Ach, lassen Sie doch das ›mein Herr‹ weg. Weder bin ich mir Vater noch ihr Vorgesetzter. Einen Adelstitel hab ich auch nicht. Kaum einer der Offiziere hat den noch. Seit den Korps-Reformen sieht man die kaum. Es zählen nur noch Taten und nicht der Familienname – Königsberg, sagen Sie? Schöne Stadt, sehr schöne Stadt. Besonders nachdem wir sie endlich von den slawischen Horden befreit hatten. Ich war ein paar Mal dort. Ich finde, dort im alten Königsberg spürt man noch so richtig den preußischen Geist. Die Russen waren nicht in der Lage, ihn auszutreiben. Die ganze Stadt atmet Preußen. In der alten Hauptstadt Ostpreußens herrschen noch Vernunft und Ordnung. Der Ort, an dem Friedrich III. zu Friedrich I. wurde. Der Geburtsort von Immanuel Kant. Ich bin sehr froh darüber, dass die Republik sich dafür entschieden hat, den Ort zurückzuerobern. Finden Sie nicht auch?«
Ich nicke nur.
Unsere Reise beginnt in der Grenzstadt Trier. Ein trostloser, bedrückender Ort. Hohe Mauern kesseln die Stadt ein. Die Dichte an Militär ist extrem hoch. Auf einen Zivilisten kommen dreißig Soldaten. Das Amt des Bürgermeisters übt ein General aus. Zutritt wird nur durch bestimmte amtliche Dokumente gewährt. Es muss ein zwanzig Seiten langer Antrag ausgefüllt werden. Die Bearbeitung dauert sechs Monate. Zum Glück übernahm mein Chefredakteur diese anstrengende bürokratische Aufgabe. Dafür bin ich ihm sehr dankbar.
Wir passieren einen mit Stacheldraht umzäunten Grenzposten, ich glaube, das ist der mittlerweile dritte gewesen, und verlassen nun das Staatsgebiet der Norddeutschen Republik und betreten das Saarland. Unser Bestimmungsort liegt noch mindestens eine Stunde entfernt. Genug Zeit, um den Offizier näher kennenzulernen.
»Wie lange machen Sie das eigentlich schon?«
»Was? Den Offiziersberuf?«
»Nein, nein – das hier.« Ich drehe meine Finger im Kreis.
»Ach das. Nun, lassen Sie mich überlegen … Müssen bestimmt schon zehn Jahre sein. Ich war vorher in Riga stationiert. Damals neigte sich der Krieg dem Ende zu. Ich wurde im Osten nicht mehr gebraucht, weswegen man mich in den Süden versetzte. Ich hatte Erfahrungen im Umgang mit menschlichem Abschaum. Für die Vernichtung lettischer und russischer Partisanen verlieh mir der alte Kaiser den ›Pour le Mérite‹.« Er öffnet seinen Mantel und zeigt mir den blau-goldenen Orden. Er funkelt und glänzt. Das blaue Kreuz sticht besonders hervor. Bisher hab ich nur wenige gesehen, die diese Auszeichnung tragen. In der gesamten Republik gibt es nach meinen Recherchen nur ungefähr einhundert noch lebende Ordensträger.
»Darauf bin ich bis heute stolz. Es ist eine meiner größten Leistungen. Die Zivilisierung des Saarlandes wird meine zweitgrößte werden. Wahrscheinlich auch meine letzte – Offizier bin ich nämlich seit über zwanzig Jahren. Irgendwann muss man auch Platz für die Jüngeren machen. Nicht wahr, Jungs?« Den letzten Satz sagt er besonders laut, damit die anderen es auch hören. Dabei streckt er seine Faust in die Luft. Die Soldaten jubeln.
»Haben Sie Vorbilder, die Sie als Ihre Leitsterne bezeichnen würden? Große Persönlichkeiten, zu denen Sie aufsehen? Die Sie inspiriert haben?«
»Vorbilder? Natürlich! Allen voran der alte Clausewitz! Sein Werk ›Vom Kriege‹ habe ich ein Dutzend Mal gelesen. Es begleitet mich seit Beginn meiner soldatischen Karriere. Sun Tzu auch und der alte Max Weber. Aber es gibt nur ein Buch, das ich in mein Herz gelassen habe. Ich würde alle Bücher der Welt verbrennen, wenn ich dieses hier retten könnte.« Aus der Innentasche seines Mantels holt er ein zerfleddertes Büchlein hervor. Der Umschlag, bereits lange vergilbt, zeigt einen Soldaten in Stahlhelm und Gasmaske – einen Sturmmann aus dem Ersten Großen Krieg. Die Seiten sind hellbraun, haben Eselsohren und Risse. Einige scheinen fast herauszufallen. Der Titel des Werks ist mir tatsächlich bekannt: »Gewitter überm Niemandsland«. Verfasst von einem unbekannten Soldaten.
»Mein Vater gab es mir, als ich noch ein Bub war. Er hatte es von meinem Großvater bekommen, und dieser von meinem Urgroßvater. Es ist ein kleines Familienerbstück. Irgendwann wird es mein Sohn bekommen.« Er seufzt, betrachtet träumerisch den Umschlag. Alte Erinnerungen scheinen durch seinen Kopf zu fluten. »Ich habe es schon etliche Male gelesen. Ich habe es im Krieg gelesen, während ich im Schützengraben lag. Ich habe es im Heimaturlaub gelesen. Damals in der Schule. Auf der Akademie. Ich werde es im Saarland lesen.«
»Haben Sie jemals erfahren, wer der Autor war?«
Er schüttelt den Kopf. »Niemand weiß es. Es heißt, er sei nach Ende des Ersten Großen Krieges nach Ostafrika gegangen und habe dort mithilfe Tausender Freischärler das Land eingenommen. Aber wahrscheinlich handelt es sich dabei nur um eine Legende. Der Nebel der Zeit hat diesen Schriftsteller, diesen Übermenschen verschlungen. Ich hätte ihn gerne kennengelernt.«
Ich möchte zu einer weiteren Frage ansetzen, als plötzlich der Laster mit einem Ruck anhält. Das Lächeln auf den Gesichtern der Soldaten wird breiter.
»So Freunde, Geschwätz ist vorbei – wir sind angekommen. Alle aussteigen und bereitmachen!«
Nachdem ich ausgestiegen bin, merke ich erstmal nicht viel von der versprochenen ›malerischen Gegend‹. Vor mir breitet sich eine kahle Fläche, eine vollkommen abgeholzte Landschaft aus. Ab und an sehe ich ein paar Hügel, auf denen Wachtürme errichtet worden sind. In einiger Entfernung erheben sich Fabrikschlote, die schwarzen Rauch in die Luft ausstoßen. Der Himmel ist grau und so ist der Boden. Es stinkt nach Schmutz und Verwesung. In der Mitte des Gebietes liegt das größte Konzentrationslager des Saarlands. Stacheldrahtzäune strecken sich beinahe kilometerweit. Baracken, Krematorien und Werkhallen sind auf dem Platz verteilt. Die schwarz-weiß-rote Flagge der Norddeutschen Republik weht im Wind.
Wir nähern uns dem Lager. Am Zaun stehen Tausende und Abertausende von abgehungerten Halbleichen, der Stacheldraht schneidet sich in ihre blassen, dürren Hände. Es kommt kein Blut mehr heraus. Das sind die Saarländer. Beim Anblick der armseligen Gestalten regt sich das Mitleid in mir. Doch mir ist bewusst, dass das alles hier für ein höheres Wohl ist – egal, wie schmerzhaft und grausam es wirkt.
Ein Wachposten kommt auf uns zu – ernste Gesichter, aber die Waffen hängen locker. Sie prüfen meinen Ausweis besonders, schauen mich skeptisch an. Sie trauen mir nicht. Verständlich, es kommen selten Außenstehende hierher. Der Offizier verbürgt sich für mich. Ich bin ihm sehr dankbar dafür.
Als wir das Lager betreten, lenkt er meine Aufmerksamkeit zuerst auf eine Reihe von Galgen, an denen mindestens zwanzig Personen hängen. Ihrem Zustand nach hängen sie dort schon eine Zeit.
»Man darf diesem Pack nicht eine Sekunde vertrauen. Man darf sie nicht zu sanft anfassen. Eine Sekunde nicht hingeguckt, bauen sie Scheiße. Einige von ihnen hatten Waffen zuhause versteckt. Andere verteilten illegal kopierte Ausgaben von ›Wilhelm Tell‹. Als ob die lesen können.« Er lacht.
Das Lager ist wirklich groß. Dutzende von Baracken stehen in Reih und Glied. Einfache, krude Konstruktionen – das Einfachste vom Einfachsten. Wahrscheinlich aus dem Holz der Umgebung gebaut. Der Offizier erklärt mir, dass die Hütten von den Saarländern selbst gebaut wurden. Sie sind auch diejenigen, die sie in Schuss halten müssen. Bedeutet also: Putzen, Streichen, Reparieren. Sie müssen ihre Nahrung eigenständig anbauen. Sie müssen ihr Essen selbst zubereiten. Nebenbei müssen sie in den Werkstätten arbeiten. Die Toten müssen sie vergraben. »Das ist hier schließlich ein Umerziehungslager und kein Kurort! Diese minderwertigen, faulen, abergläubischen Kreaturen sollen irgendwann vernünftige Bürger werden – vorausgesetzt, man kann sie auf die Gesellschaft loslassen. Einige Gelehrte glauben das ja, also dass man Wilde zu zivilisierten Menschen machen kann. Ich hab da so meine Zweifel …«
In der Mitte des Platzes stehen drei gewaltige Bilder: vom Bundeskanzler, vom altehrwürdigen Generalfeldmarschall und vom jungen Kaiser, den der Lorbeerkranz ziert. Jeder Saarländer muss, wenn er an die übergroßen Gemälde vorbeikommt, sich respektvoll verbeugen. Ansonsten wird er gezüchtigt. Dreißig Peitschenhiebe Minimum.
»Männer und Frauen sind hier durch Zäune getrennt. Die Frauen finden Sie weiter südlich. Das war bitter nötig.« Er wendet sich direkt an mich. »Wussten Sie, dass die Inzestrate im Saarland ungefähr siebzig Prozent beträgt?«
»Nein.«
»Jetzt wissen Sie es. Es ist wahr, ich wollte es ursprünglich auch nicht glauben. Die sind alle hier miteinander verwandt. Blutsverwandt, wohlgemerkt. Vetter heiratet Base. Brüder heiraten Schwestern. Mütter heiraten Söhne, Väter ihre Töchter. Und so weiter und so fort. Diese Menschen sind genetisch für Generationen geschädigt. So schlimm ist es nicht einmal in Baden, Württemberg und in Bayern. Würden wir hier nicht eingreifen, dann würden die Saarländer weiter degenerieren und sich noch mehr von der Menschheit entfernen. Wahrscheinlich würden sie sich zu einer völlig neuen Spezies entwickeln! Eine mit drei Armen und zwei Köpfen. Und unzähligen genetischen Krankheiten. Vielleicht würden sie auch einfach aussterben. Und deren Vermehrungsrate! Kennen Sie die?«
»Nein, leider nicht.«
»Eine durchschnittliche saarländische Familie produziert ungefähr acht Kinder. Im Vergleich: Norddeutsche haben im Schnitt zwei Kinder. Die vermehren sich hier wie die Karnickel! Wenn man nicht aufpasst, dann überrennen die uns! Das gilt übrigens für alle Süddeutschen. Demographische Prognosen zeigen, dass bei gleichbleibenden Entwicklungen in spätestens achtzig Jahren auf einen Norddeutschen mindestens zwanzig Süddeutsche kommen. Gut, dass wir fünfzig Prozent von ihnen sterilisieren. Ansonsten würde ich schwarzsehen für unsere Zukunft.«
»Was machen Sie mit den Kindern?« Ich frage, weil ich bisher nur Erwachsene hier gesehen habe.
»Wir nehmen den Eltern die Kinder, falls sie nicht versteckt werden, weg. Sie werden dann auf Rügen gebracht. Dort gibt es mehrere Erziehungsanstalten für süddeutsche Kinder. Die Regierung hegt die Hoffnung, dass die Umerziehung bei den Kleinen erfolgreicher ist. Die sind ja noch formbarer. Mir wäre es lieber, wir würden sie alle sterilisieren.«
Ich hörte von diesen Schulen. Der Protestantische Kirchenrat verwaltet die Anstalten. Bisher habe ich immer nur Gutes von ihnen gehört.
»Ich muss Sie das fragen, auch wenn es eventuell unangebracht wirkt, aber es gibt nicht wenige Leute, die sich für die Antwort interessieren: Was sagen Sie zu den Vorwürfen, dass das Norddeutsche Heer Kinder umbringen würde?«
Er schaut mir direkt in die Augen. Sein Blick ist voller Abscheu und Ekel. »Kinder? Pah! Verschonen Sie mich damit! Ich frage Sie: Wenn ein Kind auf Sie zugerannt kommt und eine Granate in der linken Hand hält, ist das Kind dann ein Zivilist oder ein aktiver Kriegsteilnehmer?« Er schüttelt den Kopf. »Kinder! Dass ich nicht lache. Ich kenne diese ›Vorwürfe‹ – und ich weiß auch, wer diese äußert. Irgendwelche Elfenbeinturm-Intellektuelle. Die hören von irgendwelchen Vorfällen und weinen dann Krokodilstränen. Einige der Kinder werden als Terroristen missbraucht, als Selbstmordattentäter, als Köder für unsere Männer. Aber das verstehen diese Schriftgelehrten nicht. Die sehen nur ein einzelnes totes Kind, aber nicht die Dutzend Soldaten, die sterben mussten.«
Der Offizier schnauft. Danach beruhigt er sich wieder. Auf seinem Gesicht ist wieder ein Lächeln zu sehen. »Wollen Sie mal sehen, wie wir so einen Saarländer den Schädel messen?«
Bevor ich etwas darauf antworten kann, hatte er bereits einen Soldaten herangepfiffen und ihm ein paar Befehle zugebellt. Einige Momente später kommt er wieder, im Schlepptau einen männlichen Saarländer, der wesentlich kleiner ist als ich. Die Haut des Süddeutschen hat eine graue Färbung, sein Blick zeigt keinerlei Spur von Intelligenz. Er ist leer, glanzlos.
Mein Begleiter holt aus seiner Tasche ein silbernes Gerät hervor – eine Kombination aus Zange und Lineal, ein mobiles Kraniometer. Er setzt das Gerät an Nase und Hinterkopf des Saarländers an.
»Aha! Sehen Sie?« Er zeigt mir die Messwerte. Ich muss ehrlich sein: Ich verstehe nicht so viel von der Phrenologie. Ich schaue ihn fragend an.
»Vier Zentimeter zu viel. Große Schädel, große Nasen, große Ohren. Die Saarländer ähneln mehr Schimpansen als dem Homo sapiens sapiens. Sehen Sie sich die Stirn an – wie die eines Neandertalers! Brauchen Sie mehr Beweise?«
Plötzlich bricht ein Tumult aus. Fünf Soldaten betreten unter Geschrei das Lager, sie zerren einen abgemagerten Saarländer mit. Der wehrt sich. Schreit und beißt, tritt um sich.
Der Offizier lächelt mich an. »Oh, Sie haben Glück. Sie können heute eine richtige Show erleben.«
Einer der Soldaten erklärt dem Offizier, dass sie den Saarländer aufgrund von Verbrechen gegen die Norddeutschen festgenommen haben. Er sei ein Partisan und hätte Panzer und anderes Kriegsgerät sabotiert. Sie haben ihn auf frischer Tat ertappt. Bei seiner Festnahme hat er zwei Soldaten erschossen.
»Gut. Das Urteil sollte klar sein. Erschießen Sie ihn sofort. Sollen die anderen zugucken.«
Die fünf Männer zerren den Wilden vor eine Wand. Sie legen ihre Gewehre an. Der Saarländer erhebt sich. Er beginnt auf einmal zu singen. Es ist ein kratziger, schlechter Gesang, es ähnelt mehr einem verzweifelten Schreien und Brüllen.
»Oh, I’m a good old Rebel,
Now thats just what I am
And for this Prussian Nation
I do not give a damn
I’m glad I fought against her
I only wish we won
And I aint ask any Pardon
for anything I’ve done.«
Das Knallen der Gewehre beendet den Protest.
»Was war das denn?«, frage ich.
»Ach, irgend so ein Yankee-Song aus den Südstaaten. War nach dem Ende des Bürgerkriegs sehr populär. Nur ein weiterer Beweis für die Rückständigkeit dieses Menschenschlags. Sie verbrüdern sich mit brutalen Sklavenhaltern. Es sind Barbaren. Wilde, die an überholte Glaubenssätze festhalten. Die Aufklärung muss an ihnen vorbeigegangen sein. Anders kann ich es mir nicht erklären. Sie sind dumm, rückständig, beseelt von einem Geist aus dunklen Zeiten. Als wir hier ankamen, lebten diese Menschen wie im finstersten Mittelalter. Keine Industrie, keine Infrastruktur, keine nennenswerte Kultur. Nichts. Sie kennen keinen Fortschritt. Sie kennen keine Toleranz. Sie verachten das Fremde. Sie kennen nur das Eigene. Und wie die reden! Das versteht kein Schwein! Nur noch schlimmer sind die Schweizerdeutschen. Haben Sie die mal reden gehört? Das ist doch kein Deutsch! Das ist nicht mal eine vernünftige, menschliche Sprache. Kauderwelsch, nichts weiter. Verdammte Ziegenhüter.«
Wieder schaut er mir direkt in die Augen.
»So wie wir die Rheinländer und Sachsen zivilisiert haben, so werden wir es mit den Süddeutschen tun. Wir werden sie zu Menschen erziehen. Koste es, was es wolle.« Sein Blick verrät mir, dass dieser Mann einhundert Prozent von seiner Mission überzeugt war. Es gibt keinen Grund, an seinen Worten zu zweifeln.
»Kommen Sie mit. Ich zeige Ihnen noch was zum Abschluss.«
Uns wird ein Auto zur Verfügung gestellt. Wir steigen ein. Nach zwanzig Minuten sind wir an unserem Ziel angekommen. Auf dem Weg dorthin gibt es nicht viel zu sehen – grau in grau. Abgeholzte Wälder. Der saarländische Schwarzwald soll sehr schön gewesen sein.
Der Offizier schaut aus dem Fenster. Gedankenverloren starrt er in die Ferne.
»Manchmal werfen wir Bomben auf die Siedlungen hier … einfach so.«
Mir wird eine gigantische Fabrik präsentiert. Ein grau-schwarzer Komplex, ein Amalgam aus Rohren, Platten, Gittern, Schornsteinen, Lüftungen, Hallen – keine Fenster. Unübersehbar, unüberschaubar. Als wäre ein anorganischer Leviathan mitten im Wald gestrandet. Eine urzeitliche Kreatur, die ich nicht verstehen kann. Über dem Eingang, dem Maul des Eisenmonsters, ist eingraviert worden: »Am norddeutschen Wesen soll der Süden genesen.«
»Das ist eine der größten Werkstätten in diesem Gebiet«, erklärt der Offizier. »Hier arbeiten zehntausende von Süddeutschen. Wir bringen sogar Bayern, Württemberger und Badenser hierher.« Er deutet auf die vor uns liegende Halle. »Früher stand hier eine Kirche. Eine hässliche Ausgeburt dieses paganistischen Heiligenkults, dieser römischen Seuche. Bin ich froh, wenn wir auch die letzten Brutstätten dieses rückständigen Aberglaubens beseitigt haben.«
Wir gehen hinein. Es ist dunkel und heiß. Ich spüre, wie der Schweiß hinunterläuft. Meine Kleidung klebt an der Haut. Es ist stickig. Es stinkt. Ein Fahrstuhl bringt uns nach oben, zu einer Kommandozentrale. Von dort aus haben wir einen guten Überblick über eine der vielen Produktionshallen. Ich sehe tausende von Saarländern, die an Fließbändern schwere Arbeit verrichten. Oranges Licht vertreibt kaum die Dunkelheit. Ich gebe mir gar nicht erst die Mühe, zu verstehen, was dort unten eigentlich passiert.
»Was wird hier produziert?«
»Alles Mögliche. Kriegsmaschinen, Munition, Spielzeug, Küchenutensilien, Toaster, Waschmaschinen. Was halt gerade gebraucht wird. Es wird hier angefertigt, verpackt und in die Republik verschickt. Manchmal auch ins Ausland exportiert. Seitdem die Süddeutschen Zwangsarbeit leisten müssen, ist unser Bruttoinlandsprodukt erheblich gestiegen. Momentan werden auch Planstädte hier errichtet. Sie sollen selbst Tokio und New York eines Tages übertreffen. Wenn wir hier fertig sind, wird das eine blühende Wirtschaftszone sein. Das – ist die protestantische Arbeitsethik!«
»Eine dieser Planstädte steht bereits, oder?«
»Ja, Wilhelmsbrücken – das alte Saarbrücken. Das werden wir leider heute nicht zu sehen bekommen, dafür reicht die Zeit nicht.« Er schaut nach oben, ein Lächeln umspielt seine Lippen. »Wissen Sie, wir konnten wirklich viel von den Japanern und Yankees lernen. Ihre Techniken im Umgang mit bestimmten Gruppen waren durchaus revolutionär. Auch die Sowjets waren nicht schlecht, wenn auch etwas exzessiv.«
Wir verlassen die Fabrik wieder. Der Offizier klopft mir freundschaftlich auf die Schulter.
»Nun, das ist das Ende unserer kleinen Reise. Ich hoffe, Sie hatten genug Einblicke in unsere Arbeit hier unten.«
»Die hatte ich durchaus, vielen Dank.«
»Ein Auto wird sie zum nächsten Transporter bringen, dann geht es zurück nach Trier. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise.«
»Danke sehr.«
»Vielleicht sehen wir uns ja in Österreich wieder.«
»Österreich?«
»Ja, ja. Gestern rollten mehrere Panzerkolonnen in das Alpenland. Die dortige Regierung ist zusammengestürzt, Kämpfe sind ausgebrochen und jetzt muss die Demokratie wiederhergestellt werden. Ich sag es ja, diese Alpiniden sind unfähig, sich selbst zu regieren. Wie so alle Süddeutschen. Aber wir werden das schon regeln.«
Bevor ich mich zum Gehen, abwende, packt mich der Offizier noch am Arm und flüstert in einem freundlichen Ton: »Sie versprechen mir doch, dass Sie die Wahrheit und nichts als die Wahrheit schreiben werden, nicht wahr?«
»Ich verspreche es.«
Er lässt mich los und zwinkert. Das Lächeln ist wie eingefroren auf seinem Gesicht.
Zurück in Königsberg denke ich über meine Reise nach. Nicht viele Norddeutsche wissen, was hinter der Grenze stattfindet. Nicht viele wollen es sehen. Viele kritisieren es. Viele sind angewidert. Aber nach meinen Erfahrungen muss ich sagen: Ich habe Glauben an dieses große Projekt. Wir werden es schaffen. Es wird viele Leben, viel Leid, viele Tränen kosten, doch das ist der Preis, den wir für den Fortschritt zahlen müssen. Es wird uns gelingen. Wir werden sie zu Menschen erziehen.