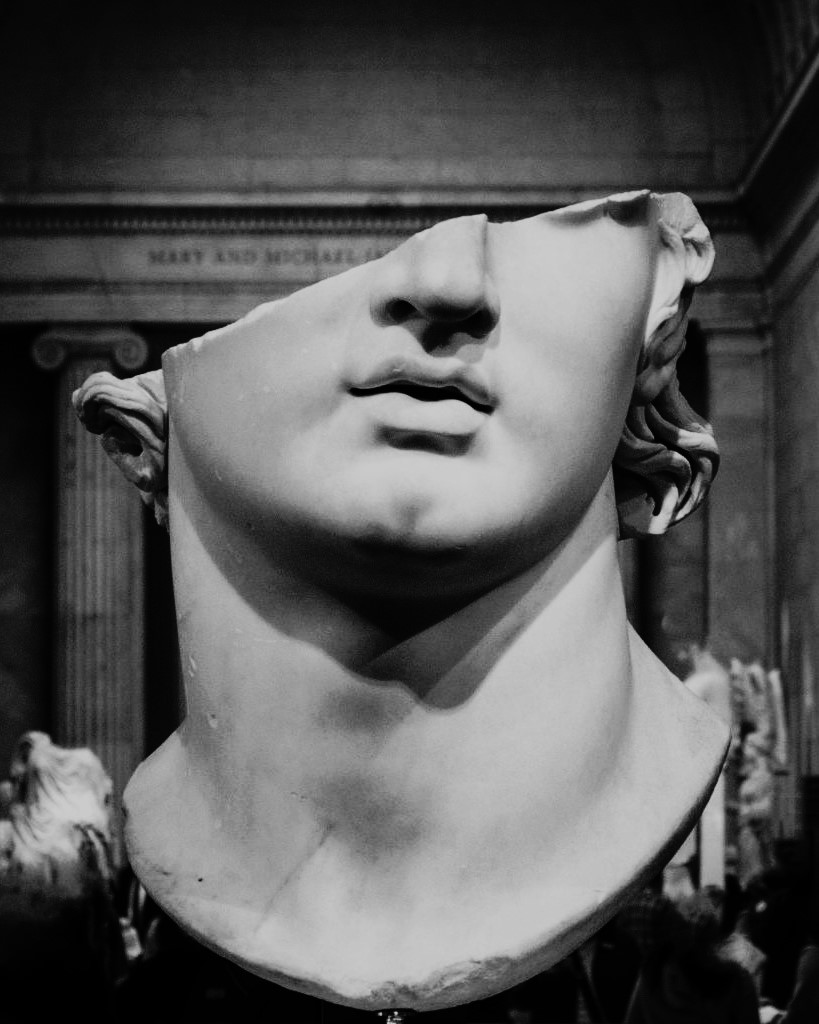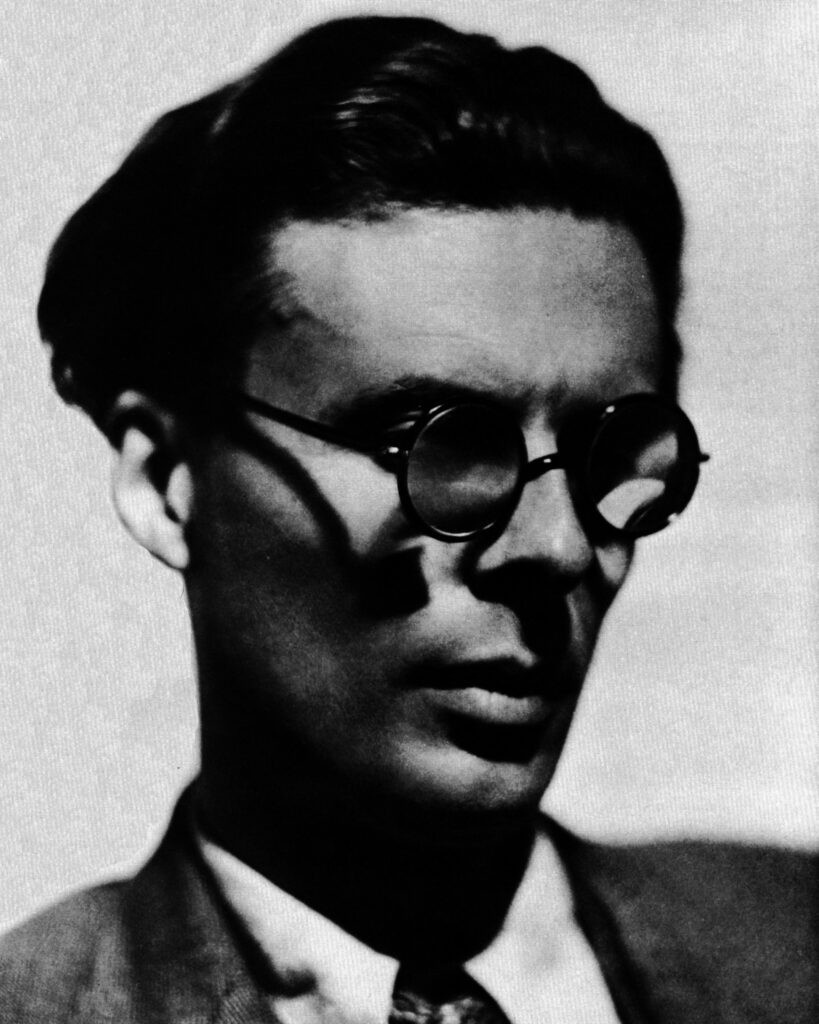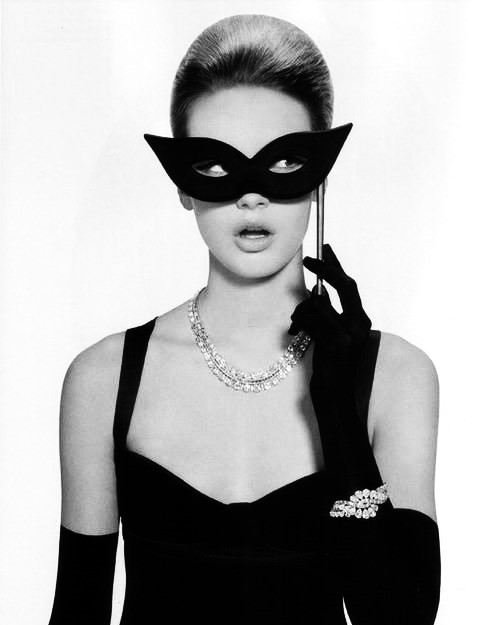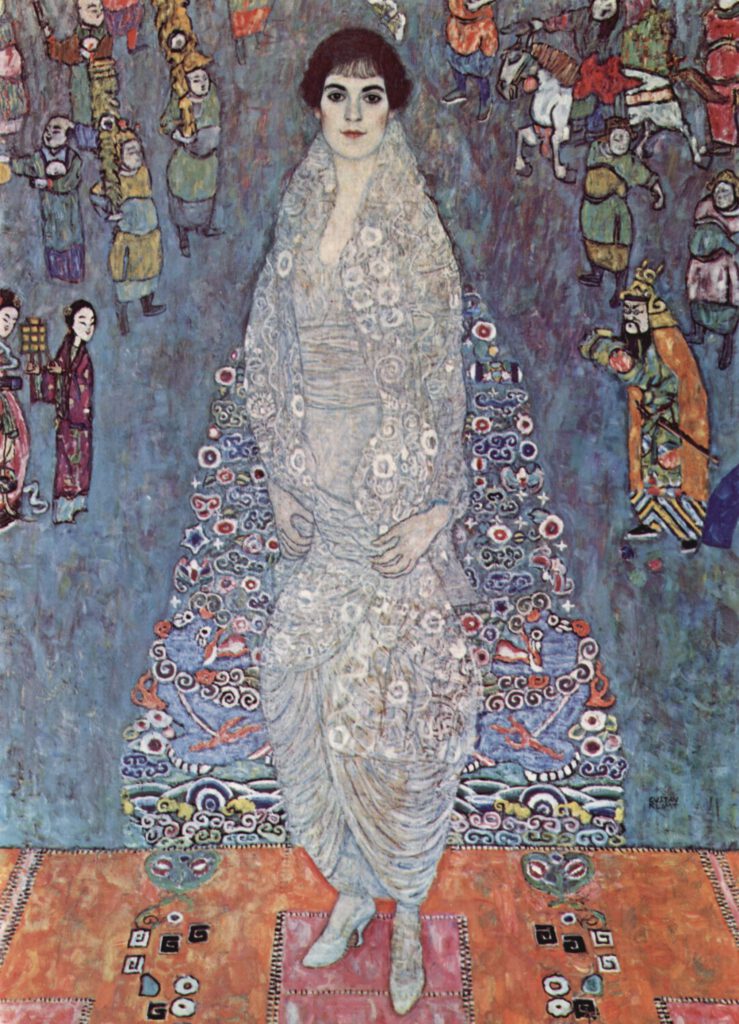„Heureux homme! Homme digne d’envie! Il n’a aimé que le Beau; il n’a cherché que le Beau!“ „Ein glücklicher Mann! Ein beneidenswerter Mann! Immer hat er nur das Schöne geliebt, immer nur nach dem Schönen getrachtet!“(Charles Baudelaire, Sämtliche Werke/Briefe, Bd. 7; München, Wien 1992, S. 163-164)
Das ruft, gegen Ende des zweiten Essays, den er Théophile Gautier gewidmet hat, sein leidenschaftlichster Verehrer aus, Charles Baudelaire, der dem „Meister der französischen Sprache“, wie er ihn nennt, kurz zuvor den Gedichtband gewidmet hat, der Gautiers Dichtungen für immer in den Schatten stellen sollte, die „Fleurs du Mal“. Baudelaire betont immer wieder die Bedeutung gerade von Gautiers Lyrik für die französische Sprache; sollte diese einmal verloren gehen oder vergessen werden, so werde man ihre Schönheit und Bedeutung mit Hilfe der Gedichte Théophile Gautiers rekonstruieren können, Gautiers, den er nicht zögert, gleichrangig neben die größten Stilisten der französischen Literatur zu stellen, neben La Bruyère, Buffon, Victor Hugo und Chateaubriand.
„Emaux et Camées“, der bedeutendste Gedichtband des reifen Gautier, erschien zu Beginn des Zweiten Kaiserreiches und in erweiterter Auflage 1858, vermutlich durch Vermittlung Baudelaires selbst, in dessen kleinem, aber piekfeinem Verlag Poulet-Malassis. Das kurze Einleitungsgedicht erklärt den artistic turn von Gautiers Poesie, seine Hinwendung zum L’art pour l’art mit Hilfe einer spektakulären Berufung auf Goethe als den größten Vorläufer: So wie dieser den ersten Napoleon gleichsam poetisch annihiliert habe durch die Beschäftigung mit der altpersichen Lyrik in seinem „West-östlichen Diwan“, so habe er den „Neffen seines Onkels“, wie Marx zeitgleich den Helden des Staatsstreichs vom 2. Dezember 1851 nennt, der sich 1852 zum Kaiser krönen sollte, ignoriert, um reine Kunst hervorbringen zu können. Dieses staatsgefährliche Treiben umschreibt mit einer meteorologischen Metapher die vierte, die Schlußstrophe des beinahe lakonisch wirkenden Einleitungsgedichts, in drei kurzen Versen:
Sans prendre garde á l’ouragan
Qui fouettait mes vitres fermées,
Moi j’ai fait ‚Emaux et Camées‘.
Schrieb ich, der Schlossen, allzugleich,
Die peitschend an mein Fenster wehn,
Nicht achtend – ‚Glasfluß und Kameen‘.
Wäre Gautier hier deutlicher geworden in seiner Praxis der Diskretion bzw. der Abkehr vom Politischen, wer weiß, so wäre vielleicht nicht erst ein Jahrfünft später Baudelaire der erste Lyriker gewesen, den das neue Regime vor Gericht gezerrt und verurteilt hätte. Der Preis für diese Entscheidung, das deuten die Gautier-Hommages Baudelaires aber auch an, ist nicht unerheblich: Vom Gesamtwerk Gautiers, so Baudelaire, sei es ausgerechnet der bedeutendste Teil, die Poesie, die dem französischen Publikum weitgehend unbekannt geblieben sei. Jeder gebildete Bourgeois kenne Gautiers Feuilletons, aber kaum einem sei bekannt oder bewußt, daß Gautier einer der größten zeitgenössischen Dichter sei. Baudelaire erklärt dies aber nicht politisch, er polemisiert gegen das französische Publikum insgesamt, das kein Sensorium für Posesie besitze.
Doch mit Gautiers Poesie hat es eine eigenartige Bewandtnis: Sie ist eigentlich nicht poetisch, so wie die Lyrik Goethes, Hölderlins, Trakls oder die Baudelaires, Rimbauds – selbst die eines Victor Hugo – poetisch ist. Es handelt sich bei ihm eher um eine eigentümliche Gedankenlyrik, keine, die Ideen ausstellt oder Botschaften propagiert, sondern eine, die spielerisch Assoziationen und Reime zu Gedankengebäuden ordnet, die das Verhältnis von Antike und Moderne auf neue Weise beleuchten: Artistische Micro-Illuminationen gleichsam; wie etwa in dem Liebesgedicht „Le monde est méchant“, das abwechselt zwischen Strophen, die klassisch die Schönheit der Geliebten preisen, und solchen, die die entsprechenden Verleumdungen der Welt, bzw. der Leute zitieren und dartun, daß es kein wahres Leben im falschen gibt, wie Adorno sagt Auf Antithesen beruht auch das schöne Gedicht: „Nostalgies des Obélisques“, das die Raubkunst Napoleons auf der Place de la Concorde dem gleichsam naturwüchsigen Bruder-Obelisken in Luxor gegenüberstellt und dem Pariser Obelisken schrille Dissonanzen andichtet:
Sur cette place je m’ennuie,
Obélisque dépareillé;
Neige, givre, bruine et pluie
Glacent mon flanc déjà rouillé (…)
Ich langweil‘ mich auf diesem Platz,
Muß – Obelisk! – verloren kranken,
Schneefall, Graupel, Taube, Spatz
Vereisen meine rost’gen Flanken.
wobei die Klage des entführten Monuments in einem schroff antithetischen Flüsse-Vergleich gipfelt:
La Seine, noir égout des rues,
Fleuve immonde fait de ruisseaux,
Salit mon pied, que dans ses crues
Baisait le Nil, père des eaux,
Le Nil, géant à barbe blanche
Coiffé de lotus et de joncs (…)
Die Seine, schwarzer Ausguß der Gassen,
Ekliger Fluß, doch in Wahrheit bloß Bach,
Besudelt mich, küßten einst steigende Massen
Des Flußvaters Nil mir die Füße gemach.
Der Nil, mit weißem Bart ein Riese,
Mit Binsen, Lotos wohlgekämmt, (…)
Ein solches Gedicht mit seinen Verfremdungseffekten lässt das auch satirische Potential von Gautiers Modernismus erahnen.Mitunter erkennt man den autobiographischen Bodensatz dieser unermüdlich abgewandelten Struktur der Antithese, die sonst eher spielerisch daherkommt. So in dem Gedicht „Aprês le Feuilleton“, das mit dem Stoßseufzer der Erleichterung eines lyrischen Ich beginnt, das nunmehr für den Rest der Woche Dichter sein, seinem Dichterberuf nachgehen darf, nachdem es die Lohnarbeit als Journalist abgeleistet hat.
Jusqu’à lundi je suis mon maître.
Au diable chefs-d’oeuvre mort-nés!
Pour huit jours je puis me permettre
De vous fermer la porte au nez.
Mein Meister bin ich grad eben bis Montag.
Legt tot schon geborene Werke zur Ruh!
Der Tage sieben, die Woche lang schlag
Ich Euch die Tür vor der Nase zu.
Nicht verschwiegen sei, daß die Unlösbarkeit eines solchen Konflikts des modernen Homo Duplex sich auch darin verrät, dass das triumphale Pathos der Schlußstrophe ein wenig hohl tönt. Erst Baudelaires Prosagedichte wie „A une heure du matin“ werden das von Gautier erlittene Künstler-Dilemma in adäquate Form bringen, und es dürfte wohl kein Zufall sein, wenn sie es in einer neuen Gattung tun, eben der des poëme en prose.
Gautier ringt sich noch nicht zu einem Verzicht auf Vers und Reim durch, sollte er ihn überhaupt je in Erwägung gezogen haben, auch deshalb, weil er ein begnadeter Reime-Finder und -Erfinder ist. Dabei kommt ihm seine Passion für Wörterbücher zugute, die dem jungen Baudelaire bei seinem ersten Besuch, den er dem berühmten Meister abstattete, deshalb auffiel, weil dieser sich ganz nebenbei bei ihm erkundigt habe, ob er Lexika lese. Gautiers Lexicoma- nie, die er in der Tat mit Baudelaire teilte, äußert sich in seiner Aufmerksamkeit für erlesene, exotische, archaische wie auch moderne Wörter und Namen; nur das Argot interessiert ihn nicht. Für Farbe sorgt auch seine Praxis des name-dropping und für Lokalkolorit die des Pariser street-name-dropping; Rue de Rivoli, rue Montmartre, le Gymnase, le bassin des Tuileries. Die topographische Identifikation von Pariser Orten im Gedicht ist Gautiers Erfindung ebenso wie das beinahe manische Nennen von Künstlernamen – Gautier kann und will den Kunstkritiker und Verfasser von Salons, der er auch ist, nicht verleugnen – oder das Zitieren von Kollegen wie Heinrich Heine, den er, Französisch korrekt, auf den Philosophen „Taine“ reimt. Zum Dank hat Heine in seinem Spätgedicht „Der weiße Elephant“ eine ironische Hommage an den Verfasser der „Symphonie en blanc majeur“ eingeflochten:
Die Dichter jagen vergebens nach Bildern,
Um ihre weiße Haut zu schildern,
Selbst Gautier ist dessen nicht kapabel –
O diese Weiße ist implacable! (Heinrich Heine, Romanzero, in: Sämtl. Werke 3/1; Düsseldorfer
Ausgabe, Hamburg 1992, S. 16)
Seine Praxis der Namennennung verrät die Sprunghaftigkeit von Gautiers Assoziationen: Unter den mehr als zwanzig Künstlernamen ist nicht einer, dessen Werk gewürdigt oder angeschaut werden würde, so wie es grandios in Baudelaires „Les Phares“, „Die Leuchttürme“ geschieht. Mitunter scheinen Künstler- oder Dichternamen vor allem als Reimwörter zu dienen:
Un vrai château d’Anne Radcliffe,
Aux plafonds que le temps ploya,
Aux vitraux rayés par la griffe
Des chauves-souris de Goya.
Das war eine Festung nach Radcliffe gemalt,
Die Decken, einst stolz, von den Zeiten gesenkt,
Die Fenster besudelt von Krallen, uralt
Jenes Fledergeviechs, uns von Goya geschenkt.
heißt es in „Inès de las Sierras. Weit entfernt, sich auf das Oeuvre Goyas einzulassen, wie es Baudelaire in „Les Pha-res“ tun wird, beläßt Gautier es bei einer Art Reim-Concetto.
Antithetische Spannung zwischen Vitalität und Vergänglichkeit kennzeichnet auch jene Gedichte, die sich wie „Coquetterie posthume“, „Tristesse en Mer“, „La Montre“ oder „Le Joujou de la petite Morte“ als ein Anknüpfen an die Tradition der Barocklyrik lesen lassen. Wobei der Poet mit der antikisierend in Gips geformten Hand einer mondänen Pariserin und der mumifizierten Hand von Lacenaire, dem berüchtigten Mörder aus der Zeit des Bürgerkönigtums Barock und Schauerromantik zusammenführt, ein Muster intertextueller Virtuosität demonstriert schon eingangs des Bandes „Etude de Mains“, das man eigentlich in extenso rezitieren müßte, um einen Begriff von der Assiziationslust und -breite wie Leichtigkeit dieses Dichters zu geben.
Ich verweise Leser wie Leserin auf den Band und belasse es beim Zitat der Schlußverse, die den schreibenden, dichtenden Mörder Lacenaire mit dem von Schumann vertonten Helden Lord Byrons auf eine Stufe stellen: „Vrai meurtrier et faux poète/Il fut le Manfred du ruisseau!“ „Er war der Manfred im Gossentiegel,/Fand Mörderschmach, statt Dichterruhm!“
Kurios genug ist die Entstehungsgeschichte des vorliegen-den Bandes, und ich will sie umso weniger verschweigen, als mit ihr die Widmung an Reinhart Hevicke verständlich wird. Eines Tages erhielt ich eine mit zittriger Hand verfaßte Postkarte eines Unbekannten, der mir für die beiden Prosabände von Gautier, die ich damals herausgegeben hatte, nur dankte, um mich eindringlich aufzufordern, auch einen Gedichtband Gautiers auf Deutsch vorzulegen und das möglichst, bevor er, der an mehreren tödlichen Krankheiten zugleich leide, das Zeitliche gesegnet haben werde. Auf die Idee, den Namen des Absenders zu googeln, kam ich nicht. So erfuhr ich erst mit Verspätung, daß mein poetischer Auftraggeber, dem ich mit dem Ausdruck des Bedauerns abgeschrieben hatte, mehr war als nur ein greiser Enthusiast. Er war selbst als Übersetzer eines großen Dichters aus Bangladesch, Abul Hasan, vor allem aber als Maler, Zeichner, und Illustrator hervorgetreten und hatte in der DDR als des Dissidententums verdächtig, für Aufsehen gesorgt, Schüler u.a. von Bernhard Heisig, was dem stumpfen Wessi, der sich wenig interessiert hatte für die Malerei der DDR, verborgen geblieben war. Auch hatte ich nicht verstanden, daß mein Korrespondent sich mit der Absicht trug, Gautiers Gedichte zu illustrieren, sobald sie in Übersetzung vorliegen würden, und daß dieses Projekt sein letztes werden sollte.
Beim Nachdenken darüber, ob nicht doch ein geeigneter Übersetzer in meinem Umkreis zu finden sei, fiel mir einer meiner begabtesten Komparatistik-Studenten ein, den ich nie ganz aus den Augen verloren hatte: Magister Michael Schöne, Dandy, Sammler von Preziosen und künstlerisches Multitalent.
Dieser kam, sah und übersetzte und präsentierte mir nach wenigen Monden einen quicklebendigen Band ingeniös getakteter und gereimter Nachdichtungen, gewürzt mit Worterfindungen und lexikalischen Impertinenzen, die dem Meister sicherlich Freude bereitet hätten. Beispiel: die Neubildung „Fledergeviech“ im Zusammenhang mit Goya!
Die leitete ich nach Berlin an Hevicke weiter, der sich beglückt, wenn auch behindert durch die Krankheit – ein Parkinson-Tremor war es wohl – ans Werk machte: Es blieb, so weit mir bekannt ist, bei einer einzigen Illustration, der zum Eingangsgedicht, von der ich eine Kopie aufbewahre. Und so kam es, das Herr Schöne, hinter einem mehrdeutig-bizarren Pseudonym verborgen, auch noch das Bebildern unseres Büchleins übernahm, ehe er dann – abrakadabra! – einen beherzten Wiener Verleger aus dem Hut oder dem Internet zauberte.
Um noch einmal Baudelaire zu zitieren, der sich kaum je in der Pose des Propheten gefiel; wenn es um das Nachleben seines Lehrers Gautier geht, schreckt er nicht vor ihr zurück: „Si dans ces époques, situées moins loin peut-être que ne l’imagine l’orgueil moderne, les poésies de Théophile Gautier sont retrouvées par quelque savant amoureux de beauté, je devine, je com- prends, je vois sa joie. (…) Avec quel délice son œil se promènera dans tous ces poëmes si purs et si précieusement ornés ! (…) Et que de gloire pour le traducteur intelligent qui voudra lutter contre ce grand poëte…“
„Wenn in jenen Zeiten, die uns vielleicht näher bevorstehen, als der moderne Dünkel wähnt, ein indas Schöne verliebter Gelehrter Théophile Gautiers Gedichte entdeckt, so ahne ich, verstehe ich, so sehe ich seine Freude. Hier endlich spricht sie zu ihm. Die wahre französische Sprache! (…) Mit welchem Entzücken schweift sein Auge in all die- sen so reinen und so kostbar geschmückten Ver- sen! (…) Und welchen Ruhm erwirbt sich der intelligente Übersetzer, der sich anschickt, wider diesen großen Dichter zu streiten…“( Charles Baudelaire, Sämtliche Werke/Briefe, Bd. 7, München, Wien 1992, S. 163)
Sprach Roland Barthes vom „Plaisir am Text“, so evoziert Baudelaire hier das Glück der Poesie, die Beglückung durch die Poesie, die dem gelehrten Wiederentdecker Gautiers ebenso heiß zuteil werde wie seinem intelligenten Übersetzer, dem, der es all jenen zugänglich zu machen weiß, denen es versagt gewesen ist, Gautiers Idiom an der Quelle zu genießen.