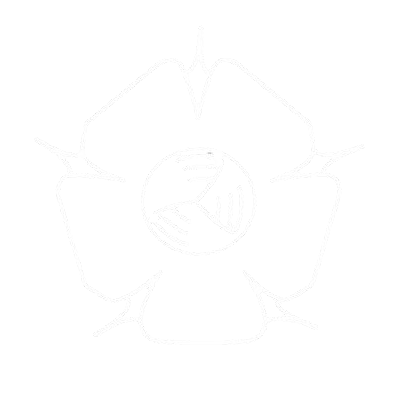Der Vater meiner Oma, Chanoch Avenary, wurde 1908 als Herbert Löwenstein in der Freien Stadt Danzig geboren und floh 1936 aus Berlin nach Palästina. 1994 wurde ihm der Israel-Preis für Musikwissenschaft verliehen. Die Preisverleihung fand im April, am 46. israelischen Unabhängigkeitstag, statt. Am 31. August desselben Jahres kam ich zur Welt, und zwei Wochen später starb er – nicht ohne meinem Vater noch einen Glückwunschbrief zur Geburt des Kindes geschrieben zu haben.
Im Mai 2020 folgte ich meinem Vater, der bereits 2013 aus Israel nach Berlin ausgewandert war, und zog nach Leipzig. Sechs Jahre später, als ich Deutschland meine Heimat nennen kann, beantrage ich die Annahme des deutschen Familiennamens meines Urgroßvaters. Die Ehrung des Vermächtnisses von Vorfahren ist in Deutschland ein verlorener Wert, obwohl alle Deutschen leicht jemanden finden könnten – auch in der jüngsten Vergangenheit –, auf dessen Leben sie stolz sein können. Hier erzähle ich seine Lebensgeschichte, die klar demonstriert, wie sehr die Errungenschaften der jüdischen Kultur in Deutschland auf Wechselwirkungen mit der deutschen Kultur und dem Christentum angewiesen sind.
Aus den Unterlagen, die meine Oma aufbewahrt, entsteht das Bild eines neugierigen, musikliebenden Menschen mit Sinn für Humor, der eng mit dem jüdischen Leben verbunden war und sich besonders für dessen Dokumentation interessierte – vor allem für die musikalische Dimension. Bereits mit 16 Jahren streifte er durch die Bibliotheken der Danziger Synagogen und kopierte Melodien eigenhändig in Notenschrift. Die Reformbewegung im Judentum hatte neue Instrumente in die Synagogen eingeführt, sodass man neben den Gesängen der Kantoren auch Orgel- und Harmoniumklänge hören konnte. Jüdische Musik – das war sein Lebensfeld, obwohl er seine Dissertation über Oswald von Wolkenstein, einen deutschen Komponisten der frühen Renaissance, verfasst hatte.
Tatsächlich blieb seine Beschäftigung mit jüdischer Musik bis zum Alter von 58 Jahren eine Tätigkeit der Abendstunden, neben der Erwerbsarbeit – aus objektiven Gründen: Schon 1931 hatte ein jüdischer Doktor der Philosophie und Kunstgeschichte kaum Chancen auf eine akademische Stelle in Deutschland. Doch essen musste man – also gründete er in Berlin einen Verlag für jüdische Kunst. Neben Kalendern und Postkarten, sämtlich von jüdischen Künstlern gestaltet, veröffentlichte er eine Esther-Rolle (eine biblische Schriftrolle zum Purimfest) in kalligrafischer Sofrut-Schrift, illustriert vom Maler Ludwig Schwerin. Parallel sammelte er weiter Material zur jüdischen Musik und ihrer Geschichte – ein besonders schwieriges Feld, da Juden erst im 19. Jahrhundert begannen, ihre Musik systematisch zu notieren.
Seine persönliche Kristallnacht erlebte er bereits 1936: Er wurde aus dem Verlegerverband ausgeschlossen und gezwungen, sein Geschäft zu schließen; einige Monate später wurde sein Onkel von nationalsozialistischen Schlägern auf offener Straße angegriffen. Obwohl er und seine Frau Thea (geb. Worzynski) zuvor keine Zionisten gewesen waren, packten sie ihre Habseligkeiten und emigrierten nach Palästina – in die Hebron-Straße des kleinen Tel Aviv. Noch im selben Jahr wurde dort meine Großmutter geboren.
In Tel Aviv nahm Herbert Kontakt zur Musikwissenschaftlerin Esther Gerson-Kiwi auf, die er bereits aus Deutschland kannte. „Um hier deinen Lebensunterhalt zu verdienen, wirst du dir etwas anderes suchen müssen“, sagte sie ihm. Und so nahm er jede Arbeit an, die sich bot. Zunächst gründete er erneut einen Verlag, den er mangels Nachfrage bald wieder schloss. Nachdem auch der Versuch, hausgemachte Marmelade zu verkaufen, gescheitert war, fand er Arbeit in einer Fliesenfabrik in Rischon LeZion, später in einer kleinen Klebstofffabrik im Tel Aviver Stadtteil Shapira.
In jenen Jahren kam er auf eine Idee, von deren Erfolg er aus irgendeinem Grund fest überzeugt war: dass sich die überschüssigen Orangenschalen sinnvoll nutzen ließen. Er überredete den Chemieprofessor Ladislaus Farkas, gemeinsam mit ihm Experimente durchzuführen. Sie versuchten, daraus Bauplatten und sogar Dünger herzustellen – mit begrenztem Erfolg.
Parallel dazu arbeitete er unbeirrt weiter an seinen musikwissenschaftlichen Studien und veröffentlichte Artikel. „Jeden Abend nach der Arbeit saß er an seinen Texten, las oder schrieb etwas – auch am Schabbat, immer mit der Pfeife“, erzählt meine Oma. „Zu Hause sprachen wir Deutsch, ebenso mit Freunden und Bekannten. Unser Haus war kein typisches jekisches Heim mit Rosenthal-Tassen, schwerem Mobiliar und festen Ritualen. Meine Mutter war früh verwaist und wanderte mit ihrem Vater zu Fuß aus Westpreußen nach Berlin, nachdem dieser infolge des Ersten Weltkriegs wirtschaftlich zusammengebrochen war. Die Atmosphäre zu Hause war daher eher von ihrer Spontaneität und Leichtigkeit geprägt. Verwöhnt wurde ich nicht: Quark, Radieschen, Brot, Meer – und wir waren zufrieden.“
„Und die Musik?“, frage ich.
„Die Musik war präsent. Gerade meine Mutter ging oft zu den Außentreppen der Philharmonie, hörte von dort zu und schlich sich in der Pause hinein. Wir waren immer über die Arbeit meines Vaters und seine Entdeckungen informiert. Jede abgeschlossene Arbeit widmete er meiner Mutter. Zwischen ihnen herrschte eine große Liebe.“
Im israelischen Unabhängigkeitskrieg wurde Herbert der wissenschaftlichen Einheit der Luftwaffe zugeteilt (auch Prof. Farkas diente dort) und absolvierte anschließend einen Offizierskurs. „Aber welche Ausbildung hatte er eigentlich?“, fragte ich. „Im Israel jener Zeit war es nicht ungewöhnlich, dass seine Experimente mit Orangenschalen ihm eine Mitgliedschaft im Architekten- und Ingenieurverband einbrachten. Für die Armee reichte das aus“, erzählt sie. „Sie prüften Materialfestigkeit, auch die Qualität von Flugzeugtreibstoff.“ Besonders erinnerlich ist ihr die Herstellung der farbigen Rauchschweife für einen Jet-Überflug am Unabhängigkeitstag. Er liebte die Einheit, wurde ihr Kommandeur und schied 1965 im Rang eines Majors aus. Unmittelbar danach begann seine formale akademische Laufbahn als Dozent und Forscher an der Hebräischen Universität Jerusalem und später an der Universität Tel Aviv.
Mich interessierte, was ihn all die Jahre ohne institutionelle Absicherung zum Weiterforschen antrieb. „Es war ihm wichtig, dass Menschen die Kultur der liturgischen Gesänge (Pijjutim) und die Arbeitsweise der Synagogen kennenlernen“, sagt meine Oma. „Zudem besaß er einen ausgeprägten Forscherdrang; jede neue Entdeckung begeisterte ihn zutiefst.“
Prof. Edwin Seroussi, selbst Träger des Israel-Preises (2018), war sein wissenschaftlicher Assistent und betrachtet ihn bis heute als seinen Lehrer. Herbert habe große Stücke auf ihn gehalten und seinen Namen häufig erwähnt. Seroussi ist überzeugt, dass er „einer der bedeutendsten Forscher jüdischer Musik im 20. Jahrhundert“ war. Seine größte Leistung sei der Artikel „Music“ in der Encyclopaedia Judaica, in dem er „einen Gesamtüberblick über das Feld gab, wie er es verstand – aus der Vogelperspektive“. Da es kaum Notenmaterial gebe, habe er vor allem mit historischen Quellen gearbeitet und „aus diesen Krümeln Delikatessen gemacht“.
Seroussi verweist außerdem auf zwei weitere zentrale Arbeiten: eine Monographie zu den Tora-Kantillationszeichen (Taʿame ha-Miqra) der aschkenasischen Juden, basierend auf Notationen nichtjüdischer Beobachter, mit deren Hilfe er die Toralesung des 16. bis 18. Jahrhunderts rekonstruierte, sowie eine Studie zu den Juden Spaniens. In einem bis heute viel gelesenen Aufsatz verfolgt er die Geschichte einer einzigen Melodie aus den Bußgebeten des Jom Kippur in ihren unterschiedlichen Aufführungen an verschiedenen Orten. Darüber hinaus entzifferte er musiktheoretische Fragmente aus der Kairoer Geniza (einem Depot alter jüdischer Handschriften), fand ein Manuskript mit Toramelodien in der Bayerischen Staatsbibliothek, verglich jüdische und christliche Musik des Mittelalters und verfasste eine Biographie des Wiener Kantors und Komponisten Salomon Sulzer.
Prof. Judith Cohen meint, Herbert habe „einen Gesamtblick auf die Musikgeschichte der Juden – überall und zu allen Zeiten“ besessen. Gerade weil er nicht in der akademischen Spezialisierungslogik sozialisiert worden sei, habe er eine solche Perspektive entwickeln können und damit zu den Begründern des Fachs gezählt. In den 1980er Jahren unterrichtete er als Emeritus Kurse zur jüdischen Musik an den Universitäten Wien und Heidelberg. Über das Interesse der europäischen Studenten am Thema spottete er gegenüber Cohen: „In jeder Gruppe saßen mindestens zwei Japaner. Die hat es interessiert.“
Aus den Gesprächen mit seinen Schülern wird deutlich, dass zwischen ihnen ein Verhältnis von Nähe und Partnerschaft bestand. Er war zugänglich und betrachtete seine Studenten als Fackelträger. Schon im Grundstudium band er sie in seine Forschung ein. Eines Tages entdeckte er ein bislang unveröffentlichtes Werk des jüdischen Komponisten des 16. Jahrhunderts Salamone Rossi. Die Madrigale – eine musikalische Form der Renaissance – ließ er von seinen Studenten in moderne Notenschrift übertragen und diskutierte sie gemeinsam mit ihnen. Das Ergebnis war eine von den Studenten herausgegebene Werksammlung. Ähnlich verfuhr er mit den aschkenasischen Kantillationen, die er in einem Buch veröffentlichte, in dem er allen beteiligten Studenten ausdrücklich Anerkennung zollte.
Ein weiterer Schüler, den er sehr schätzte, war Avraham Amzalag, Mitbegründer des Israelischen Andalusischen Orchesters. Einer seiner Doktoranden, David Halperin, verfügte über einen Abschluss in Mathematik und Kenntnisse der damals neuen Computertechnik. Mit seiner Hilfe führte Herbert vergleichende Studien zur relativen Tonhöhenverteilung durch, um mathematische Definitionen von Tönen und Strukturen zu entwickeln. Die neue Technologie schreckte ihn nicht ab.
In seinen letzten Lebensjahren veröffentlichte er zwei Schallplatten mit dem Chor „Rinat“, in Zusammenarbeit mit einem bekannten Kantor der Großen Synagoge von Jerusalem. Eine davon widmete sich der Musik der Danziger Synagoge – jenen Melodien, die er als Jugendlicher aus der Bibliothek abgeschrieben hatte. Laut meiner Oma „war es ihm wichtig, nicht nur über Musik zu schreiben, sondern den Menschen auch zu ermöglichen, zu hören, wie sie tatsächlich klang“. Über den großen Krieg wurde im Haus nie gesprochen. Die Rekonstruktion der Melodien war sein kleiner Sieg.
Mir entsteht der Eindruck, dass in einer instrumentellen Welt von Mitteln und Zwecken für meinen Urgroßvater Herbert Löwenstein, dessen Nachnamen ich tragen werde, die Beschäftigung mit Musik an sich einen Wert darstellte. Er fand in ihr Schönheit, Freude und Zugehörigkeit. Anerkennung und Urkunden waren für ihn nicht mehr als ein Bonus.
Diese Werte verdienen es, weitergetragen zu werden.