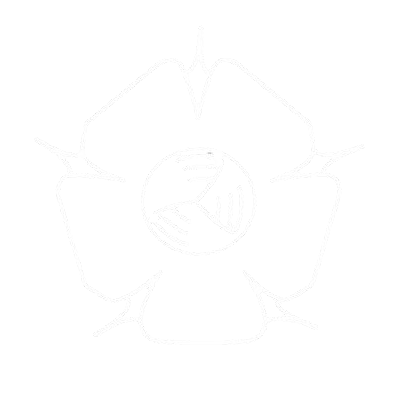Es ist ein sehr gutes Zeichen, wenn die harmonisch Platten gar nicht wissen, wie sie diese stete Selbstparodie zu nehmen haben, immmer wieder von neuem glauben und mißglauben, bis sie schwindlicht werden, den Scherz grade für Ernst, und den Ernst für Scherz halten.
– Friedrich Schegel
Der homerische Rhapsode erzählte nicht nur schöne Geschichten: es waren wirkliche Begebenheiten, deren Zeuge er zwar nicht selbst gewesen war, doch konnte die Gottheit als inspirierende Instanz den Wahrheitswert sichern. Späterhin hat das sokratische Griechentum das Fiktionsbewusstsein geschaffen; die ursprünglich nur ein einziges Mal, als Opfergabe an Dionysos, aufgeführten Tragödien wurden in ein paar privilegierten Fällen zur Wiederaufführung freigegeben.
Manche mögen bedauern, dass aus Religion Literatur geworden ist. Schlechte Leser sehen einen Gegensatz von Buch und Erlebnis, Geist und Gefühl. Jedenfalls haben wir mit der Literatur ein Kulturmittel gewonnen, das die unwahrscheinlichsten Möglichkeiten zu Faltung und Schichtung des Bewusstseins enthält.
Auch One Battle After Another wird zumeist als geradeaus politisch verstanden und von Kulturlinken entsprechend vereinnahmt, von ihren Gegner abgelehnt.[1] Dass der Film linke Gewalt inspirieren wird, halte ich für wahrscheinlich; das Internet besitzt aufnahmebereite Subkulturen. Das Leben wird wieder einmal glauben, die Kunst zu imitieren. Um im Ernst die Ironie zu sehen, in den hohen Idealen die schlimme Praxis, in den großen Worten den verkümmerten Gedanken, benötigen wir Verstand und Gefühl, die jedoch in unserer Zeit von den Ängsten des schwachen Selbst, dem Hass der Parteien und den Technologien der Kurzatmigkeit auf das Rad des Ixion gespannt werden. Die einzige Lösung ist, die Gesellschaft gut genug zu machen für die Kunst, nicht die Kunst schlecht genug für die Gesellschaft. Megalopolis.
Übrigens kommen vielleicht auf jeden so inspirierten Täter zehn andere, die schon in einem revolutionären Untergrund waren, aber – und darin könnte man durchaus die moralische Lektion des Films sehen – nun erkannt haben, dass der Terrorismus keine Lebensperspektiven und politischen Aussichten bietet.
Paul Thomas Anderson hat mit One Battle After Another seine zweite Thomas Pynchon-Adaption nach Inherent Vice vorgelegt. Nicht nur hat er kaum je einen klassisch-zusammenhängenden Plot verfasst, er kehrt in seinen Filmen auch beständig in verschiedene Jahrzehnte des amerikanischen 20. Jahrhunderts zurück, sodass das Zusammenflicken von Welt, Charakteren und Handlung aus kulturellen Registern lang geübt ist.
Man kann handwerkliche Schnitzer von bewussten Ellipsen unterscheiden, kann die Ellipsen selbst in unechte (die der Zuseher mechanisch füllt und alle Filme ständig benutzen) und substantiell erzählerische teilen und diese wiederum in klassische (das Unwichtige übergehen) und moderne (das Wichtige gerade durch Beschweigen als solches herstellen). Laufen wir PTA aber nicht mit sowas nach.
So manchem ist aufgefallen, dass sich der Leo La battaglia di Algeri im Fernsehen anschaut: bestimmt einer der gelungensten Filme über Politik. Gillo Pontecorvo drehte ihn zwar in den Sechzigern mit Finanzierung des jüngst unabhängigen Algerien, und das Ende, wenn sonst nichts, nimmt deutlich Partei für die Befreiungsbewegung. Doch die Antithese – wir wollen bleiben, sie wollen, dass wir gehen, sagt der französische Kommandant – entfaltet sich streng logisch und Schritt für Schritt. Mit einem einfachen und intelligenten Griff unterlegt der Film Bilder der Opfer und Verwüstungen beider Seiten, auch der revolutionären Bombenanschläge, mit genau demselben elegischen Musikstück. Moralische Ambivalenz ist politische Klarheit. Nicht umsonst hat Carl Schmitt festgestellt, dass der – aus dem Politischen entstandene – Kampf stets mit seinen „eigenen Mitteln“ tätig ist. So kommt es, dass „Rechts“ und „Links“ stets einander vorwerfen, was sie selbst praktizieren (Heuchelei eingeschlossen, mithin).
Wenn dieser Film hier nun anzitiert wird, dann um auf den Unterschied eines echten politischen Kampfes zu dessen Pastiche hinzuweisen. Im Gegensatz zum viril-dynamischen Ali la pointe (die Speerspitze) ist die Leo-Figur von Anfang an in realen Begriffen ein Mitläufer, in filmischen ein sidekick. Er wird eingeführt als keinen Plan habend von den Sprengaktionen, die er doch in Kürze durchführen muss – das Unplausible daran lässt den semiologischen Walzer beginnen, indem es die Kluft zum Realismus eröffnet.
Ohnehin stellt er bald in den Raum, dass er eigentlich nur für die black pussy dabei ist (eine markante Parallele zum Antagonisten). One battle sammelt eine ehrenhafte Menge Strafzettel bei der Sprachpolizei im Aufrufen eines seiner fundierenden Bildspender: dem Revolutionär als Lustmaschine, der politische Befreier als sexuell Befreiter. Nicht dass der Leo hier ein Hitzepol männlicher Vitalität wäre wie vielleicht der berühmte Terrorist Carlos im Filmportrait von Olivier Assayas, aber der Kontrast zur feministischen Verbotskultur möchte sich fast zur Hauptaussage schreiben, wenn wir das vereinnahmende Für oder Wider glücklich abgestreift haben. Eine Gestalt aus den Siebzigern, die sich genealogisch wahrscheinlich vom Rockstar herleitet, wie sich die Widerstandsgruppe als „French 75“ auf das radikale Milieu der Zeit beziehen will. In fein gestaffelter Ironie dient dazu freilich der Name eines Cocktails aus Gin, Champagner und Zitronensaft, um auch den radical chic jener Jahre anklingen zu lassen, als Terroristen zu den Parties der Reichen und Schönen und Promis eingeladen wurden. Jungle Pussy als nom de guerre einer schwarzen Kämpferin führt uns zusätzlich zu den Blaxploitation-Schundfilmen, zur Abrundung einer Zitatmatrix, die eine Schatzkammer fertiger Zeichen ausgegraben hat, geschaffen in einer Zeit, die Sex und Politik bereits in selbstgefällige Stilisierungen umgewandelt hatte. Alles zusammengehalten durch ein satirisch überspitztes Freud-Schema, wo der politische Untergrund auch der libidinöse ist, wo die weiße Ordnung vom schwarzen Begehren heimgesucht wird, wo die Phantasien der Reinheit unweigerlich kontaminiert werden usf.
One Battle After Another gewinnt Herz und Zusammenhang durch eine Familiengeschichte, aber auch vor dem hier skizzierten postmodernen Apparat verweigert die amerikanische Seele eine eigentlich zynische Haltung, und gerade indem der Anstrich des Absurden alle kulturellen Elemente – die sich doch selbst ernst nehmen – unterschiedslos durchzieht, die zwischenmenschlichen aber heilig hält, gerade weil für alle kultursemiotischen Höfe das ironische Zitat beim kritischen Verstand die Kaution hinterlegt, gerade darum können wir die in ihnen liegenden menschlichen Regungen nachfühlen, die Freiheitsphantasie der Aufständischen und die Machtphantasie der Herrscher, den billigen Selbstbetrug und die überzogenen Posen, dominante und unterworfene Lust – und vergessen wir nicht die Entspanntheit von Benicio del Toro, dem Sensei, dem Karate-Guru, den keine Razzia, Verfolgung oder Bürgerkriegszustand aus der Ruhe bringt, also das sorgsame aufgebaute Gegenbild zum Antlitz des heutigen Menschen, das entstellt ist durch Medien und soziale Medien, Politisierung und Hysterisierung.
Die Bedeutung einer Geschichte entnimmt man dem Ende. Am Ende geht die Tochter zur Demo, der Leo bleibt daheim. Ein Ende, das in einem anderen Film vielleicht als lineare, unironische Fortsetzung des Kampfes gelesen werden könnte. Doch diese Erzählung gibt die politische Aktion auf zugunsten bloßer Zeichen: aus der Revolution wird Protest durch Einsicht in ihren Unrealismus (also besagte Struktur aus Selbstbezüglichkeit, Selbstdarstellung und Selbstgerechtigkeit). Die sentimentale Zuneigung zu ihren Zielen bleibt jedoch dem Gefühl in eingeklammerter Form erhalten: die typisch romantische Bewusstseinsduplikation, die auch „romantische Ironie“ heißt. Sehnsucht.
Und so ist es bewiesen: die schlechte Ironie trennt uns vom Gefühl, die gute schmuggelt es ein.
Postscriptum: Welche Geste ist es, seitens PTA, das Politsche, die simulierte Aktualität, anzubieten und doch gleich wieder zurückzuziehen? Das Thronen der Kunst über der Zeit.
[1]Ich bemerke zur Methode, dass ich alle etwaigen Wortmeldungen der Macher selbst gemieden habe.