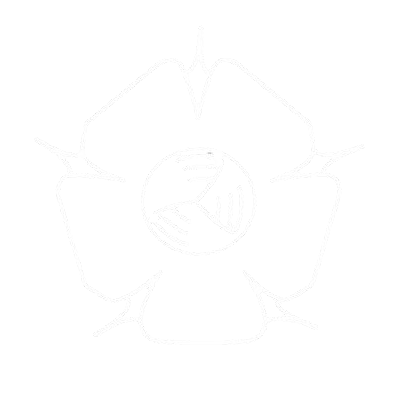Im Jahr 1903 schrieb Rainer Maria Rilke einem jungen Mann, der wissen wollte, ob er Dichter werden solle, einen Brief, der seither ungezählte Male gedruckt wurde. Die entscheidende Passage darin lautet:
„[…] Sie fragen, ob Ihre Verse gut sind. Sie fragen mich. Sie haben vorher andere gefragt. Sie senden sie an Zeitschriften. Sie vergleichen sie mit anderen Gedichten, und Sie beunruhigen sich, wenn gewisse Redaktionen Ihre Versuche ablehnen. Nun (da Sie mir gestattet haben, Ihnen zu raten) bitte ich Sie, das alles aufzugeben. Sie sehen nach außen, und das vor allem dürften Sie jetzt nicht tun. Niemand kann Ihnen raten und helfen, niemand. Es gibt nur ein einziges Mittel. Gehen Sie in sich. Erforschen Sie den Grund, der Sie schreiben heißt; prüfen Sie, ob er in der tiefsten Stelle Ihres Herzens seine Wurzeln ausstreckt, gestehen Sie sich ein, ob Sie sterben müssten, wenn es Ihnen versagt würde zu schreiben. Dieses vor allem: Fragen Sie sich in der stillsten Stunde Ihrer Nacht: Muss ich schreiben? Graben Sie in sich nach einer tiefen Antwort. Und wenn diese zustimmend lauten sollte, wenn Sie mit einem starken und einfachen ›Ich muss‹ dieser ernsten Frage begegnen dürfen, dann bauen Sie Ihr Leben nach dieser Notwendigkeit.“
Liest man diese Passage, mag man sie im Anschluss gleich ein zweites Mal lesen. Denn es steckt vieles zwischen diesen Zeilen, das über den bloßen Inhalt hinausgeht. Die Stille der Nacht, das Graben nach einer Antwort, die Wurzeln im tiefsten Herzen. Der Brief atmet eine Feierlichkeit, die dem heutigen Menschen versagt wird. Rilke schreibt, als stünde etwas auf dem Spiel, als ginge es um mehr als eine Berufswahl. Er wird der Frage gerecht, die gestellt wird: ob jemand leben darf, wie er muss, oder ob er etwas romantisiert, das nicht das Seine ist. Die Sprache ist dieser Schwere angemessen. Sie hat Gewicht, eine Schönheit, die nicht schmückt, sondern trägt.
Man stelle diesen Brief neben einen beliebigen Bestseller aus der Ratgeberecke unserer Zeit. Es wird gefragt: Wie strukturiere ich meinen Tag? Wie überwinde ich Prokrastination? Wie finde ich meine Passion? Die Sprache hat den Tonfall einer To-do-Liste, effizient. Stichpunkte statt Prosa. Fünf Schritte zum besseren Ich. Leicht verdaulich. Organisierbar. Die Form verrät bereits alles über den Inhalt: Hier wird nichts gewagt, nichts riskiert, nichts aufs Spiel gesetzt. Das Selbst ist ein Projekt, das optimiert werden will, kein Rätsel, das ergründet werden muss.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Texten durchschwemmt die Eigentlichkeit. Stil, Epoche, Tonfall – und ja, Substanz. Aber die Substanz ist nicht abtrennbar vom Rest. Sie zeigt sich gerade in der Form, in der Schönheit oder Hässlichkeit des Fragens. Rilkes Brief ist reine Ästhetik, weil die Frage, die er stellt, eine Konfrontation mit dem Abgrund zulässt. Eine Frage, die den ganzen Menschen hinter ihr meint, nicht nur sein Ergebnis. Die moderne Ratgeberliteratur ist unästhetisch, weil ihre Fragen hässlich sind. Sie reduziert die Eigentlichkeit auf Organisation. Klein, verwaltbar, ohne Tiefe. Zwischen diesen beiden Texten liegt wenig mehr als ein Jahrhundert. Und zwischen diesen beiden Texten liegt eine ganze Welt. Verschollen wie Atlantis: die Ästhetische – und mit ihr eine Art zu fragen, die uns abhandengekommen ist, mitsamt der Sprache, die ihr angemessen war.
Die Fragen, die Rilke stellte, waren Blüte einer Kultur, die sich über Jahrhunderte nach innen gewandt hatte. Deutschland kam spät zur Nation, besaß kein koloniales Ventil, keine Weltmachtrolle im achtzehnten Jahrhundert. Während England Handel trieb und Frankreich Revolution machte, vertiefte sich Deutschland. In Weimar, einer Kleinstadt von sechstausend Seelen, wirkten Goethe, Schiller, Herder und Wieland zur selben Zeit – anderswo eine Fußnote, hier das geistige Zentrum einer Nation, die politisch zersplittert war. Die Energie, die anderswo in Expansion floss, floss hier in Tiefe. Und diese Tiefe gebar jene Ästhetik, auf die man bis heute stolz sein darf. Die deutsche Philosophie, die deutsche Musik, die deutsche Dichtung – ohne Pendant in ihrer Ernsthaftigkeit wie auch in ihrer Schönheit. Denn beides bildet eine Einheit: Schönheit entsteht dort, wo jemand einer Sache auf den Grund geht, bis er nach langem Ringen mit funkelnden Schätzen emporsteigt.
Der Begriff Bildung ist bezeichnenderweise unübersetzbar. Das englische education meint Wissensvermittlung, Qualifikation, Ausbildung für einen Zweck außerhalb ihrer selbst. Bildung im deutschen Sinne meinte Selbstwerdung durch Auseinandersetzung mit dem Geist, ihn bilden. Goethe lesen, nicht um zu zitieren, sondern um den Geist feiner werden zu lassen. Die Begegnung mit den Griechen, mit der Philosophie, war kein Curriculum – sie war Transformation. Wer sich bildete, formte seinen Charakter an dem, was größer war als er selbst. Das humanistische Gymnasium war die Schmiede dieses Prozesses, das Griechische und Lateinische nicht Ballast, sondern Zugang zu einer Welt jenseits des Nützlichen – zu Fragen, weil man hinter den Worten mehr vermutet hat.
Aus dieser Kultur erwuchsen Fragen, die sich nicht mit Handlungsanweisungen beantworten ließen. Was ist der Mensch angesichts des Todes? Was bleibt, wenn die alten Götter schweigen? Wie lebt man, wenn das Absolute fehlt? Von Schopenhauer über Nietzsche bis zu den Denkern des zwanzigsten Jahrhunderts zieht sich eine Linie, die ihresgleichen sucht. Diese Fragen waren vertikal, sie setzten den Menschen in Beziehung zu etwas, das ihn überstieg: dem Sein, dem Nichts, dem Schicksal, der eigenen Endlichkeit. Sie fragten nicht nach dem Wie, sondern nach dem Wozu und dem Ob-überhaupt. Sie wagten es, keine Antwort zu akzeptieren, die nicht aus der Tiefe geschöpft war.
Und sie waren keine Nische. Die Romane Dostojewskis, der die deutschen Denker gelesen hatte, waren bekannt. Die existenzielle Dimension war kulturell präsent, nicht auf Seminare beschränkt. Ein Handwerker in München konnte Schopenhauer kennen, ein Beamter in Wien über Nietzsche diskutieren, ein Kaufmann in Hamburg die Gretchenfrage stellen. Die Fragen hatten einen Resonanzraum, weil es eine Gesellschaft gab, die sie für wichtig hielt – wichtiger als Effizienz, wichtiger als Wohlstand, wichtiger als schlichte Funktionalität, der man sich heute beugt.
Die Fragen hatten einen Resonanzraum, weil es eine Gesellschaft gab, die sie für wichtig hielt. Das deutsche Bildungsbürgertum war keine dünne Oberschicht wie anderswo; es war breit, selbstbewusst und kulturell tonangebend. Der Pfarrer las dieselben Bücher wie der Professor, der Gymnasiallehrer dieselben wie der Arzt. Bildung war eine Währung, die über Standesgrenzen hinweg galt, ein gemeinsamer Code, der vom Amtsrichter in der Provinz bis zum Verleger in der Hauptstadt verstanden wurde. Wer etwas gelten wollte, musste die Klassiker kennen – als Ausweis innerer Zugehörigkeit. Die Zeitschriften, die Salons, die Feuilletons setzten voraus, dass ihre Leser Goethe und Schiller kannten. Es gab einen Kanon, und dieser Kanon war so wirkmächtig, dass selbst seine Gegner ihn anerkannten. Franz Mehring, Marxist und Kritiker der bürgerlichen Ordnung, schrieb Lebensbilder über Schiller – eben nicht, um ihn zu demontieren, sondern um den Arbeitern zu geben, was das Bürgertum für sich beansprucht hatte. Er bekämpfte die Klasse, nicht deren Bildung. Und liegt darin nicht eine Kraft, die alles überstrahlt: wenn selbst die Feinde einer Ordnung ihre Gedanken für bewahrenswert halten?
Nun, diese Welt existiert nicht mehr. Die Gründe sind vielfältig, und es wäre vertan, sie auf einen einzigen zu reduzieren. Zwei Weltkriege haben sie dezimiert. Buchstäblich. Die Gymnasiasten, die 1914 mit Hölderlin im Tornister in den Krieg zogen, kamen nicht zurück. In manchen Abiturjahrgängen überlebte weniger als die Hälfte. Die Generation, die in den zwanziger Jahren hätte Kinder großziehen und den Kanon weitergeben sollen, lag in flandrischer Erde. Nach 1945 kam die kulturelle Delegitimierung hinzu. Die deutsche Innerlichkeit wurde verdächtig, ja verhasst. Hatte sie nicht versagt? Hatte man nicht Verse rezitiert und dann …? Die Frage war unredlich gestellt, als hätte die Bildungstradition hervorgebracht, wogegen sie eigentlich stand. Die Bücherverbrenner verachteten diese Welt. Aber die Frage wirkte, und sie wirkt bis heute nach – ein Gift, das sich durch die Generationen frisst.
Die Bildungsexpansion der sechziger und siebziger Jahre öffnete die Universitäten für breitere Schichten. Das war, je nach Perspektive, Demokratisierung oder Nivellierung. Vermutlich beides, und vermutlich mehr Letzteres. In jedem Fall ersetzte sie das Bildungsideal durch Qualifikation. Mehr Menschen gingen zur Universität, aber weniger kamen gebildet heraus. Das Ziel war nicht mehr die Formung des Charakters an etwas Größerem, sondern die Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt. Humankapital hatte den Humanismus abgelöst. Was einst Selbstzweck war, wurde Mittel zum Zweck und verlor dabei seine Wirkmächtigkeit.
Was an die Stelle trat, kam von jenseits des Atlantiks. Der amerikanische Pragmatismus fragte nicht: Was ist der Mensch? Vielmehr: Was funktioniert? Eine Perspektive, die das Fragen selbst verflacht – und wie steht es dann um ihre Antworten? Die Psychologie wandelte sich von der Tiefenanalyse, die noch nach dem Wesen des Menschen grub, zur Verhaltenstherapie, die Symptome behandelt und nach sechs Sitzungen einen Abschluss sucht. Die kontinentale Linie – Phänomenologie, Hermeneutik, das Fragen nach dem Sein – existiert noch, aber am Rand, geduldet wie ein exzentrischer Onkel, ersetzt durch einen großspurigen Stiefvater in angelsächsischer Tradition.
Die kulturelle Hegemonie verschob sich über den Atlantik, und mit ihr ihre Maßstäbe. Was heute als Bildung gilt, ist amerikanisch definiert: TED-Talks statt Traktate, Lifehacks statt Lebensphilosophie, Selbstoptimierung statt Selbsterkenntnis. Die Fragen wurden horizontal. Nicht mehr: Was bin ich angesichts des Seins? Sondern: Wer bin ich im Verhältnis zu anderen? Identität statt Existenz. Repräsentation statt Wahrheit. Wohlbefinden statt Sinn. Fern des einzelnen Geistes vor dem Abgrund steht plötzlich das vernetzte Individuum in der Gruppe, das seinen Platz in der Statistik sucht.
Die horizontale Frage ist beantwortbar. Sie lässt sich lösen durch Anerkennung, durch Gruppenzugehörigkeit, durch Status, durch die richtigen Hashtags und – im amerikanischen Stil – wohl auch durch Geld. Aber sie stillt nicht. Der neurotische Charakter der Gegenwart erklärt sich aus diesem Missverhältnis: Man erhält Antworten auf Fragen, die man eigentlich nicht stellt, und bleibt leer, schlicht Vakuum. Die Leere wird schließlich therapiert, optimiert, überdeckt mit Konsum und Zerstreuung, aber sie verschwindet nicht. Mit Widerhaken gräbt sie sich in den Einzelnen hinein. Die vertikale Achse ist kollabiert. Was übrig bleibt, ist Oberfläche, so weit das Auge reicht – und darunter das Nichts, das niemand mehr beim Namen nennt. Mittelmäßigkeit.
Selbst wenn es zynisch klingen mag: Noch lebt jener Geist in unseren Herzen. Zwar ist er überlagert, verschüttet, wie eine romanische Krypta unter barockem Prunk. Wer nur die Oberfläche sieht, vermutet nichts darunter. Aber er zeigt sich noch, in Spurenelementen, die der Überformung widerstehen – oft ohne dass die, die sie tragen, es wüssten. Doch sie spüren ihn. Er zeigt sich im Handwerker, der eine Fuge noch einmal macht, obwohl sie gut genug wäre. Im Ingenieur, der sich an einem Problem festbeißt, das längst gelöst ist, weil er spürt, dass die Lösung nicht ausreicht. Im Unbehagen an Gesprächen, die nirgendwohin führen, und an Menschen, die mehr versprechen, als sie halten. Im Misstrauen gegen das Gefällige, das Glatte, das bloß Funktionierende.
Wer diese Züge an sich bemerkt, trägt etwas mit sich, dessen Kern zu ergründen sich lohnt. Auch verdunkelt zeigt er sich noch: im deutschen Unbehagen an der Leichtigkeit, im Hang zur Schwere, im Misstrauen gegen das bloß Gefällige. Zur Schwermut geworden, wo er keinen Grund mehr findet. Was heute pathologisiert wird, war einst dieselbe Energie, die nach Tiefe suchte. Der Drang, unter die Oberfläche zu gehen, ist nicht erloschen. Er hat nur vergessen, wonach er gräbt.
Wer heute nach Substanz sucht, nach dem Eigentlichen hinter dem Gerede, wer liefern will statt performen, halten statt versprechen, der greift, ganz unbewusst, auf diese Tradition zurück. Selbst ohne Namen ist sie da. Wie ein unterirdischer Strom, der gelegentlich an die Oberfläche tritt, bevor er wieder in fruchtbarem Boden versickert.
Die vertikalen Fragen verschwinden nicht, weil niemand sie stellt. Der Tod wartet nicht auf philosophische Mode. Das Unwohlsein löst sich nicht in Therapie auf. Das Nichts bleibt, selbst wenn keiner mehr hinsieht. Diese Fragen sind älter als jede Kultur und werden jede überleben. Es bleibt offen, ob wir eine Sprache haben werden, um sie zu stellen, wenn sie sich aufdrängen.
Und vielleicht ist eben dies der falsche Blick. Vielleicht wartet die Tradition nicht darauf, ausgegraben zu werden – wahrscheinlich gräbt sie selbst. Wie Wurzeln, die durch Asphalt brechen, weil es ihre Natur ist zu wachsen. Vielleicht ist es gerade das eigene Vakuum, das manche bis an den Grund treibt, weil sie spüren, dass die Oberfläche nicht zu tragen vermag. Ein Boden, asphaltiert mit Phrasen, auf dem kein rechter Fuß Halt finden kann – warum sollte er dann? Die Kultur, die uns heute auf jenem Asphalt gefangen hält, ist dieselbe, die den Wunsch erzwingt, nach dem Grund zu suchen. Die Krankheit gebiert die Sehnsucht nach Heilung. Wer diesen Wunsch in sich bemerkt, steht bereits in einer Linie, die nicht abgerissen ist, nur wartend wie Glut unter Asche.
Wie also bläst man diese Glut wieder zur Flamme? Wie öffnet man sich den großen Fragen neu, ohne dass es eines Ratgebers bedarf, der die Antworten vorkaut? Und eben dies ist die falsche Haltung: eine Haltung des Konsumenten, der empfangen will, bevor er gesucht hat. Nicht die Antwort gilt es zu finden, sondern die Frage zu ertragen – lange genug, bis sie den Steller formt. Vielleicht tut man gut daran, den Dingen ihre Zeit zu geben. Das Buch beiseite zu legen, das einem die Welt erklärt, bevor man sie selbst gesehen hat. Das Internet auszuschalten, das einem Meinungen liefert, bevor man eine eigene gebildet hat. Die Stimmen abzustellen, die ständig auf einen einreden, bis man die eigene nicht mehr hört. Das Empfangen einzustellen – radikal, unbequem –, im Vakuum zu verharren und zu warten, bis sich in der Stille etwas regt. Eine Ahnung vielleicht, noch vage, noch tastend, wie ein Tier, das aus dem Winterschlaf erwacht.
Den Feldweg selbst zu bestreiten, und erst wenn etwas in einem selbst antwortet, ist man bereit, diese Ahnung in die Wirklichkeit zu tragen. Sie wetzt sich an dem, was widersteht, bis sie scharf wird. Sie prüft sich am Widerstand der Dinge, an den Menschen, am eigenen Versagen. Und dann, erst dann, die Großen aufzusuchen, die denselben Weg gegangen sind – um zu erfahren, dass man nicht allein ist mit dem, was einen umtreibt. Dass andere vor einem dieselbe Stille ausgehalten haben und nicht daran zerbrochen sind. Wer sich dieser Tradition stellt und sie annimmt, wer Rilkes Frage an sich selbst richtet und nicht ausweicht, der tritt ein in etwas, das größer ist als er. Und vielleicht wird derjenige, der heute in der stillsten Stunde seiner Nacht die Frage stellt, morgen derjenige sein, der sie anderen zu beantworten vermag.
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.
— Rainer Maria Rilke