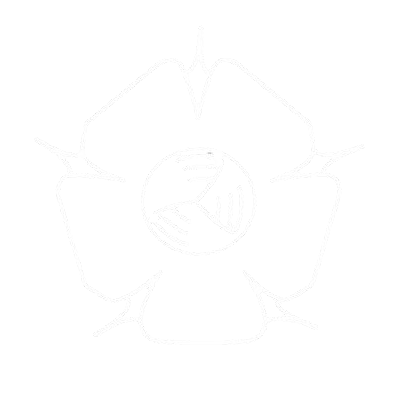De nobis ipsis silemus
— Immanuel Kant
Den guten Rat, von sich zu schweigen, vermag ich leider nicht zu befolgen. Denn als Ernst Bertram starb, war ich gerade fünfzehn Jahre alt. Als Kind bin ich ihm begegnet, als Kind habe ich ihn besucht, als Kind von ihm gelernt. Bertram war ein gewissenhafter Lehrer; ähnlich wie Stifters Hagestolz besaß er ein Herz für Kinder—sein Patenkinderbuch erzählt davon. „Für uns“, schrieb er in seinem letzten Brief an mich, „ist es ein Geschenk, wenn wir an junge Menschen Hoffnungen knüpfen dürfen für eine Zukunft, die wir nicht mehr sehen werden.“
Er schenkte gern, ließ sich auch gern beschenken. Kindern begegnete er mit einer gewissen Ehrfurcht und bewies ihnen mehr Respekt als mancher allzu würdigen Respektsperson. Schon deshalb wäre es falsch, im Folgenden auf alles Persönliche zu verzichten. Schließlich schreibe ich über einen Mann, dem ich mehr verdanke als ein paar schöne Bücher.
Mit Büchern hat es allerdings begonnen. Sigismund Rüstig, das deutsche, allzu erbauliche Gegenstück zu Defoes Robinson Crusoe, war das erste Buch, das ich von ihm erhielt—versehen mit dem Vermerk: „…das Lieblingsbuch meiner Kinderzeit.“ Es ging weiter, passend zu meinen zunehmenden Jahren: Rheinlandsagen, allerlei Tierbücher, eine Geschichte der Entdeckungsreisen, schließlich Ernst Galls großes Bilderwerk Dome und Klosterkirchen am Rhein, „zu erwandern in vielen schönen Ferientagen künftig“, wie er den Titel handschriftlich ergänzte.
Wenn ich nach Köln zu Besuch kam, führte der erste Weg zu Boisserée, der Buchhandlung gegenüber dem Heinzelmännchen-Brunnen, wo das von ihm für mich bestellte Buch dann bereits bereitlag. „Die Dinge gehören dahin, wo sie am meisten Freude machen“, pflegte er zu sagen, wenn man sich bedankte. Von diesen Dingen—lauter künftigen Geschenken—besaß er viele, und er wusste erstaunlich genau, wo sie und wem sie die meiste Freude machen würden.
Sein Haus in Köln-Marienburg bewohnte er allein, versorgt von einer Zugehfrau, die ihm den Haushalt führte. Das große Gartenzimmer ging nach Südwesten; davor ein Rasen, durchwachsen mit ein paar Gänseblümchen, die der Gärtner auf seinen ausdrücklichen Wunsch beim Mähen zu verschonen hatte.
Zwischen den hohen Fenstern eines halbrunden Erkers standen auf vier schwarzen Postamenten die Häupter von Goethe, Stefan George, seinem Freund Ernst Glöckner und eines Jünglings aus hellenischer Zeit—für den, wie Bertram gelegentlich erzählte, ein Gutteil seines väterlichen Erbes draufgegangen war.
Davor stand ein großer, schwerer Tisch, auf dem ungezählte Schallplatten lagen. Bertram war, ähnlich wie Thomas Mann, ein großer Freund des Grammophons. Er war ein guter Klavierspieler und kannte sich in der Musik aus; was eine Variation, eine Reprise und eine Fuge ist, habe ich zum ersten Mal von ihm gehört. „Ein Erzieher“, zitiert er Nietzsche in seiner großen Monographie, „ein Erzieher sagt nie, was er selber denkt; sondern immer nur das, was er über die Sache im Verhältnis zum Nutzen dessen denkt, den er erzieht.“ Zitate waren für ihn kein bloßes Bildungsgut, sondern Verpflichtungen—auch für andere.
Über sein Äußeres findet sich einiges bei Thomas Mann, mit dem ihn eine schwierige, von Vorwürfen und Missverständnissen durchzogene, am Ende aber doch bewährte Freundschaft verband. Der reserviert-formelle, selbst zeremonielle Professor, der bei den Manns in München oft zu Gast war, ist Bertram. Als Paten seiner Tochter Elisabeth beschreibt ihn der Hausherr in leicht ironisch getönten Hexametern:
Der anhängliche Freud, im wohlgeschnittenen Gehrock,
Bürgerlich vornehm, ein wenig altfränkisch, der deutsche Gelehrte
Und Poet, voll kindlich artigen Frohmuts, jedoch dem
Leiden vertraut, dem Geiste enger verbunden durch Krankheit,
Die ihm fürs Leben vermählt und periodisch ihn martert.
So sah er aus in jenen Jahren, in denen neben den Betrachtungen eines Unpolitischen auch Bertrams Nietzsche-Buch entstanden war—von Thomas Mann feierlich, wie er betont, zum besten Buch der letzten fünf Jahre erklärt. „Bestochen von seinem unaussprechlichen Reiz“, bekennt er, diesmal wohl ernsthaft: „Wie kein neueres liebe ich das Buch.“
Soviel zum Äußeren. Vom Inneren dieses rätselhaften Mannes habe ich als halbes Kind nur seine hellen Seiten wahrgenommen, die dunklen allenfalls geahnt. Bertram war schwierig, launenhaft, zwei- oder dreideutig, und er wollte das auch sein. Das Offensichtliche war ihm verdächtig; er liebte die Anspielung und das Rätsel, Pathos und Ironie. „’Trotzdem’ ist das heiligste Wort“, ein Rhabanus-Zitat, setzte er als Motto über seine Schwarzen Sonette.
Sprach man ihn auf sein Versteckspiel an, pflegte er sich auf Conrad Ferdinand Meyer herauszureden, der seinen Hutten sagen lässt: „Er sei kein ausgeklügelt Buch, er sei ein Mensch mit seinem Widerspruch“—das u gedehnt. In einem der fiktiven Briefe, die er 1936 unter dem Titel Von der Freiheit des Wortes veröffentlichte, schreibt er an einen jungen Mann: „Wolltest du dich sehen, würdest du dich lähmen“—eine Anspielung auf Kleists Episode vom schönen Jüngling, der zufällig bemerkt, wie ihm die Pose des Dornausziehers glückt, sie dann bewusst wiederholen will und kläglich scheitert. Solche Geschichten musste man im Kopf haben, um Bertram zu verstehen.
Er war ein Proteus, der mal mit dieser, mal mit jener Stimme sprach und sich der Nachfrage entzog. „Maske“ heißt das Kapitel seines Nietzsche-Buchs, in dem er sich selbst die Maske vorhält und ausmalt, wie es ist, sich selbst vor sich verwandelt zu sehen und zu handeln, als wäre man wirklich in einen anderen Leib, einen anderen Charakter eingegangen.
Nietzsche und Stifter, Kleist und Flaubert und immer wieder Goethe—lauter Masken Bertrams.
Diesen Mann unmittelbar zu befragen, war nie der sichere Weg zu einer sicheren Antwort. Maria Pawlowna, die Weimarer Erbprinzessin, lässt er berichten: Gab man Goethe aber Gelegenheit, eine treue Beobachtung, ein naiv gegenständliches Geschautes durchsichtig zu machen gegen ein einwohnendes Gesetz, dann „antwortete es aus ihm“, wie er sonst nie geantwortet hätte. Es antwortete aus ihm—in diesen drei Wörtern steckt das Geheimnis der Dichtung: Sie lebt aus sich selbst; der Dichter ist nur ihr Mundstück.
Homer war blind, behauptet die Legende: ein Instrument der Muse, die alles sah und alles wusste. So ähnlich dachte wohl auch Bertram. „Das höchste Gedicht“, meint er in einem seiner Aphorismen, „sei Zauberspruch.“ Der Dichter ist für ihn ein Magier, ein blinder Seher—deshalb lieben ihn die Kinder:
Zauberspruchverwandt war das Gedicht,
Das uns Kindern die Getreue las;
Von den leisen Zeilen floß ein Licht,
Drin sie als ein Regenbogen saß.
Das alte Bild von der Magnetkette, die ihre Kraft von Glied zu Glied überträgt: Platon gebraucht es für Ion, den törichten Rhapsoden; Bertram für eine ältere Frau, die Kinder mit den Geheimnissen der Poesie vertraut macht.
George hatte gefragt: „Kommt Wort vor Tat, kommt Tat vor Wort?“ und an die Spartaner erinnert, die im Notfall den Dichter vorriefen, dessen Vers das Heer ertüchtigte und spender ward des langvermissten Siegs. Bertram mochte ähnliches erhofft haben, als er Zuflucht bei seinem Hausfreund Adalbert Stifter suchte und notierte:
„Männer schreiben jetzt auf, was geschieht, und das wirkt in die Zeiten.“
Denn die Worte seien so mächtig, dass sie alles bewegen, während das Recht der Taten die Menschheit gestaltet. „Das Wort ist stärker als die Wurfschleuder, und die Mäßigung besiegt den Erdkreis.“
Das schrieb er zu einer Zeit, als sich die Nationalsozialisten anschickten, Polen zu überfallen, Europa zu erobern und der Welt den Krieg zu erklären. Das Vorrecht des Dichters, Möglichkeiten in Wirklichkeit zu verwandeln, hatte sich in die Utopie verflüchtigt.
Bertram war nicht blind gegen die Wirklichkeit. Wie Gerhard Hauptmann, Hans Carossa oder Gottfried Benn hatte er die braune Machtergreifung mit Erwartungen begleitet, die immer gründlicher enttäuscht wurden. Das erste der Schwarzen Sonette, erschienen im Winter 1938/39 „mit Genehmigung des Insel-Verlags“, trägt den Titel Trauer und beginnt:
Wir hatten uns ein hohes Volk erdichtet,
Das weisend über dunklen Völkern strahlte,
Der erzne Hüter einem künftigen Grale—
Nun siehe da, wie unser Traum gerichtet!
Das „hohe Volk“, der „künftige Gral“—alles nur erdichtet. Der Lyriker mochte den Möglichkeiten nachtrauern; der Zeitgenosse wusste, dass es zu spät war.
Um der Realität zu entkommen, verlor er sich in versunkenen Reichen wie Atlantis oder Vineta. „Wie wäre es“, fragt er in der Maske Stifters, „wenn Zeit und Raum gar nichts Wirkliches wären?“ Wenn Gott und andere Geister in Zeitlosigkeit lebten, eigentlich Ewigkeit? Keine Zukunft, kein Wissen in die Zukunft—nur ein Wissen überhaupt.
Nur das Gedicht kann dieses Niemandsland erschließen und ist deshalb immer weiser als der Dichter selbst. Es wird nicht gemacht—es wird gefunden wie ein Edelstein:
Mir selbst ist meine Härte nicht bekannt:
Geliebter Geist, sei du des Schleifers Hand.
Ich selber weiß um meine Farben nicht.
Ich bin der Stein; mein Kind, sei du das Licht.
So wie der Schleifer den Stein zum Leuchten bringt, hat der Dichter das Vorgefundene zum Sprechen zu bringen. Dichten ist Arbeit—poiesis—und bei der Arbeit kann man Fehler machen. Daher auch seine Scheu vor dem Wort. „Sobald unser Denken Worte gefunden hat,“ zitiert er Nietzsche, „ist es nicht mehr innig, nicht mehr im tiefsten Grunde ernst.“
„Sagt doch auch der Dichter: sobald man spricht, beginnt man schon zu irren.“
Diese Angst nimmt er so ernst, dass er seinem Nietzsche-Buch ein längeres Goethe-Zitat voranstellt, das vor dem Sprechen warnt: „Wir alle sprechen zu viel. Wir sollten weniger sprechen und mehr zeichnen.“
Ganz ähnlich heißt es bei Bertram selbst in den Aphorismen von 1938/39: „Nennung zerbricht den Zauber. Daher darf dein Gedicht niemals nennen, sondern nur ahnen lassen.“ Oder kürzer: „Sage mir, was du ahnst, und ich sage dir, wer du bist.“
Wie in der Sprache war er auch in der Natur den Phänomenen auf der Spur, die er „Vorauferinnerungen“ nannte: edle Steine, in denen die Natur Zukünftiges vorausahnt.
Maria Pawlowna berichtet von einer Schale aus Moosachat, die Goethe ihr schenkte, weil sie über vermeintliche Versteinerungen gesprochen hatten. „In solchem Achat“, erläuterte Goethe, „träumt der Stein zu einer Zeit, da es noch kaum ein Grün auf Erden gab, von künftigem Moos und Wald.“
So suchte auch Bertram das Zukünftige im Vorhandenen—nicht durch Beobachtung, sondern durch Deutung.
Doch er war nicht nur Dichter und Deuter, sondern auch Redner, Hochschullehrer, Kritiker, Philologe. Deshalb ist es schwer, den Kreis seiner Neigungen abzustecken: Neben dem gläubigen Stifter stand der sarkastische Flaubert, neben der Freundschaft zu Thomas Mann seine Verehrung für Stefan George—und vieles mehr. Was diesen Kreis zusammenschloss, war sein Glaube an den Wert der Kunst und die Berufung des Künstlers.
Unter den französischen Romanciers war ihm Flaubert der liebste, da er für ihn den „Typus des spätesten, des letzten Künstlers“ verkörperte.
„Das Religiöse,“ schreibt Bertram, „geht auf die Form selbst über.“ Der Künstler wird „Diener am Wort“. Eine neue Askese, eine Selbstopferung für die Kunst.
Was Bertram vom Künstler verlangt, ist Ehrlichkeit. „In der Kunst könnt ihr nicht lügen“, ruft er den Banausen zu. Diese Ehrlichkeit—Nietzsche hätte von „Reinlichkeit“ gesprochen—nimmt ihn für Flaubert, Stifter, Kleist, Maupassant, Lichtenberg, Fontane ein.
In seinem Aufsatz über Flauberts Briefe heißt es, meisterlich formuliert:
Hier gibt es keine „fatalen posthumen Überraschungen“, keine Retouchen, keine schielende Rechtfertigung. Keine „angeschminkte schmucklose Wahrhaftigkeit“ gewisser Selbstbiographien. Selbst Nietzsche findet bei Flaubert nichts von der „Koketterie des Leidens“, die seinen eigenen Briefen manchmal anhafte. Von Flauberts Zeugnissen sagt er:
„Hier ist die Einsamkeit, aber ohne Tremolo, der Verzicht ohne Gebärde, die Verachtung nicht ohne Liebe.“
Das alles ist Flaubert. Und es ist auch Bertram.
Damit komme ich zu Nietzsche. Bertram war früh in dessen Schatten geraten und hat ihn nie verlassen. So wie Flaubert der letzte Künstler, war Nietzsche für ihn der späteste Philosoph. Im Nachlass fand ich eine Abschrift einer Notiz, in der Nietzsche seine Angst gesteht:
„Was ich fürchte, ist nicht die schreckliche Gestalt hinter meinem Stuhle, sondern ihre Stimme … nicht die Worte, sondern der schauderhaft unartikulierte und unmenschliche Ton jener Gestalt.“
Bertram war zu gewissenhaft, um einen Jugendlichen damit zu bestürzen. Doch über Nietzsches Zusammenbruch in Turin, über sein Dahinsiechen in Weimar und über die Rolle seiner Schwester Elisabeth—das „Lama“—habe ich zum ersten Mal von ihm gehört.
Nietzsche zu zitieren, habe er gelegentlich gesagt, sei eigentlich verboten: Man könne mit ihm alles belegen, da er zu allem auch das Gegenteil gesagt habe—„mit Ausnahme der Vorsokratiker“, fügte er hinzu; bei ihm hieß das: mit Ausnahme Heraklits.
Heraklits Fragmente, gesammelt von Diels, verwandelte er in einen Dialog: Ein Alter übergibt zwei jungen Leuten ein unlesbares Buch: „Der dies Buch schrieb, verkündet euch nichts und verbirgt euch nichts, sondern er deutet euch an.“
Unbedingte Größe gestand er nur wenigen zu: Goethe und Johann Sebastian Bach, gelegentlich Brahms, zur Festspielzeit sogar Wagner. Mozart mochte er nicht—nannte ihn „rosa und hellblau“. Ein groteskes Fehlurteil, aber typisch für seine leidenschaftlichen Vorlieben und Abneigungen.
Kunstbände aus seinem Besitz waren durchzogen von kleinen Wertmarkierungen: Kreuz für gut, zwei Kreuze für beachtlich, Doppelkreuz mit Unterstrich—selten—for exzellent. Mit derselben Hartnäckigkeit, mit der er Claude Lorrain, die Romantiker oder Hans von Marées in den Himmel hob, verfolgte er Bernini und andere Barockkünstler mit seinem Missfallen: sogar der Trevi-Brunnen bekam ein deleatur.
Er war ungerecht—und wollte es sein.
Zu seinen liebenswürdigsten Eigenheiten gehörte der Brauch, Museumsbesuche mit der Wahl einer „Leihgabe“ zu beschließen. „Ich nehme das“, pflegte er zu sagen. „Was nimmst du?“ Oft so laut, dass Wärter näherkamen und dann beruhigt wieder weggingen, als sie den vermeintlichen Dieb sahen: einen älteren Herrn im schwarzen Anzug mit breiter Krawatte. Ihm traute man nichts Schlimmes zu; seinem minderjährigen Begleiter auch nicht.
Widersprüchlich wie er war, schien er nach Laune zu entscheiden—doch wer die coincidentia oppositorum, Heraklits große Entdeckung, als Lebensregel kennt, weiß, dass sein Urteil dem Gefühl gehorchte. Wie Nietzsche hätte er sagen können: „Ich bin, abgerechnet den décaden, auch deren Gegenteil.“
Die deutsche Sehnsucht nach dem Süden nannte er die „älteste und edelste Gefahr“ der Deutschen. Ob er die Varusschlacht als Unglück oder als Glück betrachtete, blieb unklar. Wie Flaubert liebte er das Traurig-Groteske. „Es entspricht den intimen Bedürfnissen meiner spaßhaft bitteren Natur“, zitierte er.
Er liebte Flauberts Bouvard und Pécuchet, die Tragikomödie des Intellekts, und empfahl sogar das spröde Dictionnaire des idées reçues. Vielleicht glaubte er wirklich, was er bei Nietzsche zu finden meinte: dass der geniale Zustand eines Menschen der sei, in dem er „zu einer und derselben Sache zugleich in Liebe und Verspottung steht“.
Verlässlich war er nur in seiner tiefen Abneigung gegen jeden Dogmatismus. „Den Meistern der Rechtgläubigkeit erblindet das Wort“, schrieb er in einem Brief. „Rechtgläubige haben keine Dichter.“ Die katholische Kirche, deren Vertreter in Köln den Alltag sichtbarer beherrschten als heute, war ihm Hort der Orthodoxie—und schon äußerlich zuwider.
Gern erzählte er eine wahrscheinlich erfundene Anekdote vom Autodafé, bei dem Giordano Bruno verbrannt wurde. Kurz vor der Hinrichtung habe ein Mönch dem Ketzer ein Kruzifix vorgehalten, von dem dieser sich verächtlich abgewandt habe. „Ja, wenn man das erst auf dem Scheiterhaufen tut“, bemerkte Bertram, „ist es natürlich zu spät.“
Was wird von ihm bleiben? Vielleicht das eine oder andere Gedicht—„Kammermusik“, wie er seine Lyrik nannte. Thomas Mann war großzügiger. In den 1920er Jahren bemerkte er, die Grenzen zwischen Wissenschaft und Kunst würden verwischt, der Gedanke erlebnishaft durchblutet, die Gestalt vergeistigt; ein neuer Buchtypus entstehe: der „intellektuelle Roman“. Als Musterstück nannte er Bertrams Nietzsche-Buch, das damals sechs Auflagen erlebte. Inzwischen liegt die siebte vor.
Von Bertrams Sehnsucht nach der Utopie blieb nichts. Sie war von Natur aus ein Phantom—weil sie in der Vergangenheit lag. Wie die Romantiker war er ein rückwärtsgewandter Prophet, geblendet von Möglichkeiten, die ihm den Blick auf die Wirklichkeit verstellten.
Wer ihn gekannt hat, denkt bescheidener und erinnert sich an einen liebenswerten Menschen, der Halt in der Freundschaft suchte, weil er das Tragische am Ende doch nicht komisch finden konnte. Über die Freundschaft hat er in einer Sprache geschrieben, die nicht vergessen werden sollte:
Du kannst nicht sein, du kannst dich nur verschwenden,
Kannst bleiben nicht, die Erde wandert aller Enden;
Du kannst nicht sammeln, jedes Gold wird Blei,
Und nichts ergreifen, alles schwirrt vorbei;
Du kannst nichts wissen, denn es ward schon Trug.
Du kannst nur lieben. Lieben ist genug.
Als erfahrener Interpret hat Bertram dazu gesagt: „Über den Rang eines Gedichtes entscheidet in den meisten Fällen sein Schluss. Auf ihn zielt, auch unwissentlich, der Bogen in der Hand des Meisters.“
Am 1. Mai 1957 erhielt ich von ihm eine Postkarte mit Beethovens Totenmaske, einen „schönen Sommer“ wünschend. Der 2. Mai war der Erinnerung an seinen früh verstorbenen Freund Ernst Glöckner gewidmet. Am 3. Mai ist er gestorben.