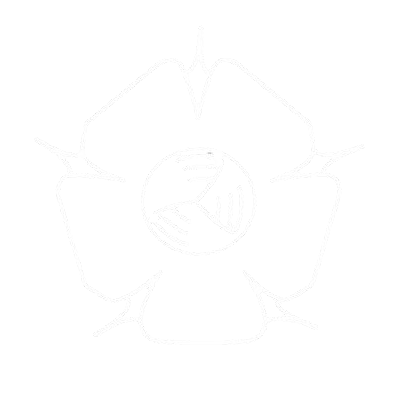Der Mythos ist etwas Ambivalentes. Er ist Wirklichkeit, zumal Wirk-lichkeit, und lebt doch von unserem Nicht-Sehen, Nicht-Dort-Sein, Nicht-Dabeisein und ähnlichen Nicht-Erkennungen. Er bedarf des Schleiers. Seine Wirkung erzielt er durch die Andeutung der Formen hinter diesem, nicht zwingend, wie sie wahrhaftig sind, aber wie sie auf uns wirken oder wie wir auf sie wirken im Wechselspiel unserer Selbst und der Dinge in der Welt, in die wir ebenfalls gleichzeitig hineingestellt und gewissermaßen von ihnen entrückt sind.
Wie unsere Existenz zum guten Teil auf innerweltlicher Nicht-(Mehr-)Existenz beruht und Nicht-Existenz ebenso auf Existenz sich gründen kann, wie es im Fall einer verlorenen Heimat und den Leben der Vertriebenennachkommen ist, wenn wir nicht der Beliebigkeit nachhängen, die das Individuum als zufällig irgendwo geboren und genauso gut als dieses auch auf einem anderen Boden möglich betrachtet, sondern eine gezielte Schöpfung, einen Willen Gottes, eine urtümliche Verbundenheit annehmen und proklamieren, dann kann gefragt werden, wo wir wären, wäre die verschollene Heimat noch.
Diese Frage läutet sie entweder ein oder entsteht bereits aus der Entrückung, die sich ganz natürlich aufgrund der historischen Ereignisse ergibt. Geschichten werden erzählt, die Erinnerung an die Kindheit, den Schulweg, Grenzgebiet, polnische und volksdeutsche Dörfer, zur Schule ging‘s nur vier Jahre, da wurde auch entschieden, dass dieses Datum ein schöner Geburtstag sei, da man den zuvor nicht wusste, man hatte keinen Kalender daheim, wo sich sechs Kinder aufgereiht ein Bett teilten. In der Scheune konnte man so schön von oben ins Stroh springen. Eine Puppe hatte Leokatja, die haben ihre Brüder vergraben. Ob sie wieder gefunden wurde, weiß ich nicht. Aber die Kinder halfen beim Viehhüten. Man ging schwimmen im Fluss und das Kleid schwamm davon.
Das Kleid schwamm davon. Eines der ikonischsten Bilder, die sich in meinem Kopf formten und ganz grundsätzlich zur Erinnerung an meine Großmutter gehören, an den Mythos von Ostpreußen, der aus dieser Wirklichkeit, diesen Geschichten, die stark auf mich wirken sollten und damit weiterhin in Form der Persönlichkeitsbildung Realität schufen. Wie das Kleid davon schwamm mag zugleich sinnbildlich dafür stehen, wie die Geschichte ausgeht, jeder mag es ahnen. Die Kutschen fahren an der Ostsee entlang, junge Mädchen trinken Salzwasser, der Vater blieb am Hof, die Brüder fielen in Frankreich und in Russland und meine Großmutter bekam einen neuen Namen: „Hier heißt man nicht Leokatja.“ Die Traumatisierung der Großeltern vernahmen oft auch wir Enkel noch. Sie sind fort oder eben hier, das Land ist fort. Man kann ja hinfahren, aber das Antlitz des Landes, die Heimat ist fort. Zurück blieb der nackte Mensch, doch nackt nur materiell, es kleidet uns die Geschichte und so als Geistiges.
Der Mythos ist da, solang wir in seiner Wirklichkeit stehen. Explizit in der Wirklichkeit und nicht in der Realität oder Wahrheit. Wahrheit und Wirk-lichkeit sind zwei verschiedene Ebenen, wenn sie sich auch verbunden sein können. Es ist dann kein Widerspruch zu behaupten, die griechische Mythologie entspräche der Wirklichkeit und Jesus Christus sei der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Ob es zum Mythos beiträgt oder ihn zerstört, hinzufahren, kann ich bislang nicht beantworten. Klar ist aber: für uns wäre er ja gar nicht da in dieser Form, wäre die alte Heimat nicht fort, würden wir einfach dort leben; dann gäbe es eben andere Mythen, aber dies wäre unsere Realität. Der Mythos ist dasjenige, was bloß diesseitige, plastische Realität und dahinterliegende Wirklichkeit scheidet.
Das zeichnete sich auch bei Platon noch ab und daran, dass alles europäische Denken nur Fußnoten zu Platon darstellt, ändert auch der Aristotelismus mit seinen bis in die Moderne ausufernden Verwirrungen, wenig. Im Grunde ist alles große, erhabene Denken eine Folge Platons und alles Niedere, in die Welt reduzierende ein Spross des Aristoteles, der mit der Erhaltung der Ideen in den Dingen selbst statt als vorgelagerte Entitäten die Brücke zwischen Welt und Gott kappte. Bei Platon haben wir immerhin einen Rest des Nebeneinanders bis hin zur Verbindung des Mythos mit dem Logos noch, die sprachhistorisch eng zusammenhingen, ganz plastisch etwa in Höhlen-, Sonnen- und Schiffergleichnis (Rep. 514a-520a, 508a-509b, 488a-489d), die didaktisch der logischen Erörterung in nichts nachstehen. Bei Homer bezeichnete der Mythos das gesprochene Wort, die Rede, die gewichtige Erzählung, ebenso wie der Logos Wort und Rede, aber auch Sammlung, Berechnung und Verhältnis meinte. Dem Mythos aber kommt, im Gegensatz zum subjektiven Logos das Objektive des Wirklichen, des Tatsächlichen zu. Erst im Laufe der Zeit, beginnend mit den Vorsokratikern, weiter ausgeformt stärker bei Aristoteles, denn bei Platon, bezeichnete Logos das vernünftig Geordnete, das rational Dargelegte, während der Mythos sich auf die heilige, symbolische Geschichte zu beschränken begann. Aus dieser Aufspaltung des menschlichen Denkens erwächst die destruktive vermeintliche Dichotomie, die in Rationalismus, Empirismus, mit ihnen Positivismus und die Überhöhung des aufklärerisch-trockenen Verstandes bei gleichzeitiger Beschränkung darüber hinausgehenden Denkens und Fühlens bis hin in konstruktivistische Spielarten führen sollte.
Die Ideenlehre des Platon, die das metaphysische Vorhandensein der Ideen an sich beschreibt, ist aus christlicher Perspektive schon dadurch notwendig, dass der Schöpfung das Denken und der Wille Gottes vorausgehen müssen, wenn auch nicht zwingend zeitlich, da die Zeit ein Geschaffenes ist, so doch logisch. Die Ideen können, wo es einen Schöpfer gibt, nicht bloß in den Geschöpfen enthalten sein, denn diese weisen zwar vereinende Gattungen und Arten auf, doch ist die Variation in diesen zu groß, um die von diesen unabhängige Idee zu leugnen. Daran ändert auch der aristotelische unbewegte Beweger nichts, der gegenüber dessen Metaphysik wie ein bloßer Zusatz wirkt, vor dem aber die besagte Lücke klafft, wo Platons Ideen die Verbindung bilden.
Demgegenüber wirft Aristoteles vor, leere Worte und poetische Metaphern zu verwenden. Als derjenige, der die Logik zur Disziplin erhob – sei dies als Beschreibung der Gesetze der menschlichen Ratio, sofern sie eben nur dies ist, noch so löblich – kommt ihm, sonst würde er die poetischen Metaphern nicht als Vorwurf verwenden, bereits ein Zugang zur Wahrheit abhanden, hat er doch bereits mit der Leugnung der Existenz der Ideen an sich, unabhängig von der Welt, Schöpfer und Schöpfung gewissermaßen voneinander abgetrennt. Durchaus wohnt der platonischen Metaphysik etwas Mythologisches inne, ergibt sie doch nicht nur Sinn, sondern muss im philosophisch-protoreligiösen Selbstexperiment in ihrer Wirklichkeit begriffen werden, auf einer Ebene, die ich Anfassung nennen möchte und die – wenn auch das geistige Werk und mit ihm jede Geschichte und Tradition auf dem Logos beruht – über den Verstand hinaus geht und dessen Negation sowie die Negation der Negation fordert.
Auch die Kunst war einst – oder ist es vielleicht noch immer, für immer – mit dem Mythischen verknüpft. Auch von sakralen, religiösen Haltungen und Handlungen war sie unabtrennbar. So könnte man sagen: Kunst ist wirklich, wenn sie mythisch ist. So heißt es in Aristoteles‘ Poetik, es ginge in der Dichtkunst darum, wie die Mythen zusammenzufügen seien, damit die Schöpfung schön werde. (1447a) Schönheit hängt hier unmittelbar am Mythischen, was gar nicht verwundert, wenn der Mythos „nicht bloße Erzählung, sondern lebendige Wirklichkeit“ ist, „ein ursprüngliches Geschehen, das ununterbrochen die Welt und das Schicksal der Menschen beherrscht und bestimmt“, wie es in Malinowskis Myth and Primitive Psychology heißt. (Vgl. E. Grassi: Kunst und Mythos. S. 79f.) Der Mythos ist keine intellektuelle Erklärung oder künstlerische Phantasie, er kann nicht erfunden werden – wir kennen diejenigen, die behaupten, ein neuer Mythos müsse her und dabei gar nicht begriffen haben –, sondern als höhere und wichtigere Wirklichkeit nur gefunden. Das Kunstwerk, die Literatur und der Ritus stehen dann nicht autark da, weisen auch nicht bloß über sich selbst hinaus, sondern sind selbst schon Interpretation. So ist auch das Geschehen im Ritus, in der Kunst gar der Mythos selbst, ist doch das Wort sein Träger. Nach homerischem Verständnis ist der Mythos „Wort als unmittelbares Zeugnis dessen, was war, ist und sein wird, als Selbstoffenbarung des Seins in dem altehrwürdigen Sinn, der zwischen Wort und Sein nicht unterscheidet“, zitiert Ernesto Grassi in seinem Werk Kunst und Mythos Walter Friedrich Otto. (Ebd. S. 81)
Wenn Wort und Sein im Mythos ineinander fallen, dann zeigt sich dies nicht nur in antiken Vorstellungen und nicht als bloßes Erzählmuster, sondern als eine Weise, Wirklichkeit zu erschließen und fortzuführen. Eine solche mythisch verdichtete Form des Erinnerns begegnet uns dort, wo Literatur eine vergangene Wirklichkeit in ihrer Wirk-lichkeit fortleben lässt. In diesem Sinn kann die Literatur zur Trägerin eines Wirklichkeitsüberschusses werden, der mehr bewahrt als das bloße Faktum. So wird in Hans Graf von Lehndorffs Werk Menschen, Pferde, weites Land die untergegangene Welt Ostpreußens noch einmal lebendig, in dem er auf liebevoll-schillernde Weise seine Kindheit und Jugend auf den Staatsgestüten in Graditz und Trakehnen beschreibt, die Menschen, die Dörfer, ganze Landstriche in detailreichen Nahaufnahmen, durchstromert mit der Büxe und durchstreift auf dem Rücken der Pferde, die hier das Leben aller Gesellschaftsschichten so sehr prägten. Von Querfeldeinrennen, Dorf- und Kinderfesten und der Arbeit der Stallmeister, der Knechte und Reitburschen, die die jungen Pferde zuritten, in einer Zeit und einem Weltbild, in der der Stallbursch in seiner Würde als Stallbursch sein durfte, weitgehend unangetastet von rechtem Überlegenheitswahn und linker Verkehrung des Arbeiters.
Einer dieser Charaktere ist der Jurastudent Heinrich Maul-Ballupönen, der auf seinem Pferd Jubellaut, einem Trakehner, das größte Geländerennen Ostpreußens gewann, sich durchsetzend gegen eine Konkurrenz bestehend aus Vollblutpferden. In seiner Freizeit sich als Dichter betätigend, blieb er unbekannt. Ein Werkkanon ist nicht überliefert, unter den wenigen Gedichten aber eine Zusammenbruch und Verstummung verdichtende Imagination der inneren Lage Hölderlins in jenem Jahr, eine Art lyrische Maskenrede:
Hölderlin 1806
Da wurde alles Denken schwer und tief
und wie ein Grübeln um verlorene Träume,
und jene alte starke Stimme rief
nur selten noch in seines Schweigens Räume.
Dann lauschte er und suchte sich zu sammeln
wie einer, der aus schwerem Schlaf erwacht,
und sein ihm selber fremdgewordenes Stammeln
gab flüsternd Antwort in die weite Nacht,
daraus der Ruf ihm, halb vertraut, gekommen.
Doch als der letzte ferne Ton verweht,
da fühlt er, wie er ratlos und beklommen
in einem ungeheuren Schweigen steht,
das endlos leer und kalt und ohne Farben
bis an die letzten Horizonte rührt
und wie aus Augen, welche längst erstarben,
mit unentwegten Blicken auf ihn stiert.
Da graut ihm, denn in diesem Meer von Stille
Verhallen seine Worte hoffnungslos.
Er schweigt – und langsam sinkt sein kranker Wille
Noch tiefer in des ewigen Dunkels Schoß. (H. G. v. Lehndorff: Menschen, Pferde, weites Land, S. 89)
Endlos leer und kalt und ohne Farben, in ungeheurem Schweigen ist auch die Welt ohne Mythos, die Welt des Positivismus. Heinrich Maul und Jubellaut aber erscheinen selbst als tragisch-protomythische Gestalt. Jubellaut starb, nachdem er mit ihm an einem Distanzrennen in Spanien teilgenommen hatte, an den Folgen einer solch großen klimatischen Umstellung, worüber sein Reiter zeitlebens nie hinwegkam – ein Zeugnis einer der aufrichtigsten und selbstlosesten Arten der Liebe, die es auf dieser Welt gibt, der zum Tier. Heinrich selbst fiel im Zweiten Weltkrieg vor Riga. Symbolhaft glitzern die Menschen, Orte und Begebenheiten vor dem Hintergrund ihrer Zerstörung, tragen eben dadurch zum Mythos im Kleinen bei. Zu Ende gelesen habe ich das Buch Hans Graf von Lehndorffs seit nunmehr drei Jahren nicht, ist es doch so wunderbar, zumindest in der literarischen Welt Hitler und den Krieg nicht kommen, die faktische Welt nicht untergehen zu lassen: „Wenn die Schneeschmelze kam und die Elbe über ihre Ufer trat, wurde es auf den Elbwiesen aufregend. Dann schlugen die vom Frühlingssturm gepeitschten Wellen gegen den Damm, und man stand vor einer unübersehbaren Wasserfläche, aus der die Bäume manchmal nur noch mit der Krone herausragten. Wilde Gänse und Enten trieben hoch am Himmel oder tief über den Schaumkronen dahin, und große Greifvögel, die man sonst nicht sah, jagten nach Beute. Ein Stück Urwelt war in unser wohlbehütetes Dasein hereingebrochen, und oft stand ich tief bewegt und im Innersten aufgewühlt an irgendeiner sturmgeschützten Stelle, um möglichst viel von dieser wilden Musik in mich aufzunehmen und mich von ihr in meine Träume begleiten zu lassen. Ich sehe die Landschaft ins Unermeßliche geweitet. Keilförmig geordnete Züge von Wildgänsen ziehen himmelhoch in den verschiedensten Richtungen über mich hinweg. Ich höre ihr eifriges Geschnaggel und fühle mich ihnen sehnsuchtsvoll verbunden.“ (Ebd. S. 17)
Schon das ist Mythos, symbolischer Ausdruck von Urerlebnis, schon das ist Wirklichkeit – das Religiöse vermag zugunsten der Ewigkeit nur die unheilige Seite der Zeit oder des je menschlichen Zeitverständnisses berechtigterweise abzulehnen, doch im Mythos werden wir hineinversetzt und steigen hinauf in die Ereignisse, die gewesen sind und doch andauern, denn dies ist die heilige Seite der Zeit. Dass Erzähler und Zuhörer in eine heilige und mythische Zeit versetzt werden, heißt es auch bei Eliade. Durch den Mythos als Grassis Rahmen des Beständig-Waltenden geraten wir in ein Begreifen, das über bloßes Verstehen erhaben ist, lässt uns auf die höheren Wahrheiten hinblicken, denen hier ein Abglanz geschaffen ist und denen wir begegnen, nachdem wir wahrgenommen, gedacht, gelesen und wieder gedacht, verstanden und begriffen haben – im Angefasst-werden im Herzen. Der Mythos ist das Wirkliche für den, der noch fühlt. Die Steigerung von emotionaler Berührtheit durch Verpaarung mit Logos und Mythos wie Tag und Nacht ist die uns in das All mit einbegreifende Anfassung. Mit Novalis ward die Nacht zu der Offenbarung seliger Schoß – und doch: unser aller Sonne ist Gottes Angesicht. (Novalis: Hymnen an die Nacht, Nr. 5)
Aristoteles: Poetik. Reclam, Leipzig 1994.
Ernesto Grassi: Kunst und Mythos. Rowohlt, Hamburg 1957.
Hans Graf von Lehndorff: Menschen, Pferde, weites Land. Biederstein, München 1980.
Novalis: Hymnen an die Nacht. Contumax, Berlin 2016.
Platon: Sämtliche Werke, vgl. insb. Politeia. Rowohlt, Hamburg 1993.