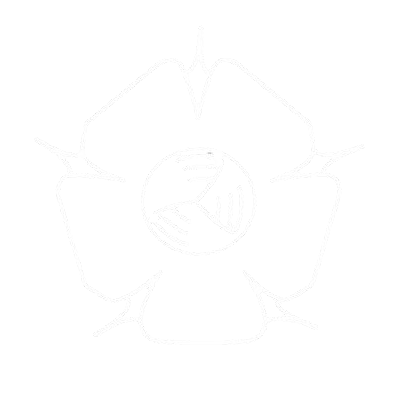Während des Papsttums seiner Heiligkeit Pius XI. verkündigte sein damaliger Kardinalvikar im Bezug auf die sittliche Krise des 20. Jahrhunderts unmissverständlich:
„Ein Kleid kann nicht als anständig bezeichnet werden, wenn es tiefer als zwei Fingerbreit unterhalb der Halsgrube ausgeschnitten ist, wenn es die Arme nicht wenigstens bis zu den Ellbogen bedeckt und kaum über die Knie hinausreicht. Darüber hinaus sind Kleider aus durchsichtigen Stoffen unangebracht.“
Es ist beinahe unmöglich davon auszugehen, dass die Bezirksleiterin der Caritas, die gerade vor mir sitzt, sich nicht den Vorsatz genommen hat, gegen beinahe jede in dieser Erklärung dargelegte Disziplin der Moral zu verstoßen. Ich mustere ihre Schlüsselbeine genau, während ihre Halsgrube dazwischen unaufhörlich von ihrer endlosen Tirade vibriert.
„Im Allgemeinen, Pater, ich richte das hier nur als Bitte an Sie, weil ich mir denken kann, wie schwierig es sein muss, sich bei einer neuen Pfarre zurechtzufinden …“
Dabei braucht man kein Maßband, um zu erkennen, dass ihr Kleid nicht nur mehr als zwei Fingerbreit unter ihrer Halsgrube geschnitten ist. Sondern – so unmissverständlich wie die Verkündigung des Kardinalvikars – die Grube zwischen ihren kleinen Hängetitten entblößt.
„Trotzdem bin ich sicher, dass Sie um die Lage des Behindertenwerks hier im Ort wissen. Man hat dort seit Jahren um ein höheres Budget vom Land geworben, aber bis auf die Krankenhäuser kriegt niemand mehr Gelder. Dabei wird der Bedarf immer größer. Es hilft natürlich auch nicht, dass die Altenheime in so einem kleinen Dorf logischerweise völlig überfüllt sind.“
Mein Blick ist weiterhin auf ihre „Bekleidung“ gerichtet, nun unter dem Schreibtisch, von dem ich etwa einen halben Meter entfernt in meinem Drehstuhl gelehnt sitze: auf die kniehohen Lederstiefel und die Jeansshorts. Ich frage mich, ob das Tragen von Stiefeln über dem Knie als eine angemessene Bedeckung des Knies zu werten ist. Eine Frage, die sich logischerweise erübrigt, da das Tragen von Shorts einen weitaus eindeutigeren Verstoß, das Tragen von so kurzen Shorts wiederum einen himmelschreienden Verstoß gegen die Sittlichkeit erfüllt. Ihre Cellulite machen das kaum erträglicher.
„… Also, dazu übrigens noch ein interessanter Gedanke. Wir könnten dafür auch öffentlich und gemeinsam Gelder sammeln. Ich habe letztens mit dem Pfarrer der Freikirche …“
„Gemeinde.“
Sie schaut mich verdutzt an.
Der Begriff „Kirche“, erkläre ich, steht einer Institution zu, die sich in Kommunion mit dem römischen Bischof befindet. Sogar das II. Vatikanische Konzil weitet diesen Begriff im Dekret Orientalium Ecclesiarum lediglich auf die Orthodoxen und Ostkirchen aus – aufgrund der anerkannten apostolischen Sukzession, die diese schismatischen Kirchen nachweisen können.
Sie setzt an, von ihrer Altenwerkstatt oder was auch immer weiterzureden. Meine Belehrung lässt sie scheinbar unberührt. Sie kreuzt ihre massiven, von Cellulite umringten Fleischklotze über die Knie, was ihr nur gelingt, indem sie mit beiden Händen einen Lederstiefel über das Bein wuchtet. Sie verkündet irgendetwas vom Gemeinderat – nicht der Gemeinde der Freikirchen, sondern der säkularen Gemeinde des Dorfes – und verabschiedet sich schließlich mitsamt ihren Hängetitten.
Ich bleibe zurück und lese in den Dokumenten des II. Vatikanischen Konzils nach. Tatsächlich müsste ich sie zurückrufen lassen, um mich selbst zu korrigieren. In dem mir vorliegenden Kommentar werden auch die anglikanischen Gemeinden in die Definition der Kirche einbezogen. Meine Finger krallen sich zitternd um die Seiten, Schweiß tropft von der Nasenstege meiner Brille. Ich schlage das Buch mit Schnappatmung zu und tröste mich mit der Erleichterung, wenigstens nicht zu spät für meinen nächsten Termin zu sein.
Ein Termin, der nicht auf dem Kalender steht, den meine Pastoralassistentin für mich angefertigt hat. Nach monatelanger Ermahnung trägt sie in meiner Gegenwart tatsächlich Bekleidung, die zumindest einer sehr liberalen Interpretation der Erklärung des Generalvikars von Pius XI. entspricht. Trotzdem kommt mir sporadisch der Gedanke an Selbstentzündung, wenn ich die Jobbeschreibung „Diakonin“ auf ihrem Namensschild lese – was, in Bezug auf eine Frau, gegen die Bullen und Lehren einer kaum zählbaren Masse von Päpsten und Kirchenvätern verstößt.
Ich stelle also sicher, dass sie das Pfarrhaus bereits verlassen hat, bevor ich die Vorhänge vor jedes Fenster meines Büros ziehe. Nach ein paar Minuten trifft Pater Nikolas in Begleitung eines Messdieners und Bruder Pius ein – der ironischerweise seit letztem Jahr ein Kastrat ist, obwohl Pius X. die Beschäftigung von Kastraten im Sixtinischen Chor verboten hatte.
Nikolas wirft die Dokumente zum II. Vatikanischen Konzil nach einigem Blättern unbeeindruckt zur Seite und entzündet sich erneut seine Zigarette, die in der Zwischenzeit erloschen ist. „Diese Kommentare entstehen wie Fliegen um Mist – wen kümmert das.“
„Also, rein theoretisch gesehen …“, fängt Bruder Pius an, und ich bilde mir ein, dass seine Stimme seit seiner Kastration tatsächlich etwas höher geworden ist.
Nikolas fährt ihn scharf an, verweist auf Apostolicae Curae von 1896, erklärt anglikanische Ordinationen für null und nichtig und verspottet Hoffnungen auf Internetkonvertiten aus der UK.
Inzwischen legt der Messdiener den versprochenen Revolver auf meinen Schreibtisch und entnimmt pflichtbewusst jede Patrone, um sie der Reihe nach vor mir aufzustellen. Unter seinem Hemd erkenne ich bei 35 °C das Cilicum – ein Büßerhemd aus Wildschweinborsten, offenbar zusätzlich mit Stecknadeln bestückt, was die dunkelroten Flecken an seiner beigen Anzughose bestätigen.
Der Schmerz, wie jeder weiß, ist die Poesie in der Sprache der Liebe. Und der Schmerz in der Strafe ist nicht weniger als das Hohelied des Menschen, für den es keine schönere Dichtung gibt, in der er zu Gott singen könnte.
Ich hole die Liste hervor, die ich an diesem Morgen vorbereitet habe, und berichte, dass wir die Adresse der Ferienwohnung von Bischof Bräuning ausfindig machen konnten. Nikolaus zieht anerkennend die Mundwinkel nach unten und gibt die Liste nickend an den Messdiener weiter.
„Aber bitte vor Ostern“, mahnt er. „Wenn ich noch einmal diese Fratze am Altar im Dom sehen muss.“
Ich lehne mich wieder in meinen Drehstuhl zurück. Die Entspannung endet abrupt, als mir wieder in Erinnerung kommt, dass ich mich wohl doch um dieses was-auch-immer der Caritas-Tusse kümmern muss.