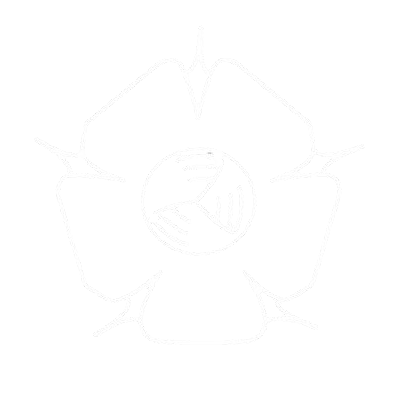Für Noel
Springen ist leicht. – Man muss nur wissen, wofür und weswegen;
wissen, woher und wohin: Schwer ist nur der Entschluss…
Gute Worte, wahrlich. Elegisches Distichon. Aber was helfen sie jetzt noch, jetzt, in der letzten, einsamsten Stunde? Denn er muss sterben, heute Nacht.
Empedokles steht am Rand des Kraters. Herbstnacht. Der Wind peitscht gegen seinen Umhang, schlägt ihn zurück, als wolle er ihn packen, wie eine zweite, unsichtbare Hand. Für einen Augenblick stolpert er – beinahe wäre der Wind sein Vollstrecker gewesen. Beinahe.
Noch gestern hatte er es zu Pausanias gesagt, feierlich, beinahe selbstzufrieden:
»Menschsein heißt: die Frage nach Unendlichkeiten
Tief und herzeigen in sich jagen und brennen zu sehn.«
Und Pausanias hatte die Worte nachgesprochen, mit jenem gläubigen Schimmer in den Augen, der Empedokles entsetzte. Da wusste er, dass es zu Ende war. Die Menschen wollten in ihm einen König sehen, einen Gott, ein Prinzip. Aber er selbst – er wusste, dass er nur Empedokles war.
Es war Pausanias’ Blick, der seinen Sprung besiegelte. Die Reinheit, die Erwartung, die kindliche Verehrung. Nein, er konnte nicht mehr zurück.
Und jetzt? Jetzt steht er hier, im Nachtwind, und weiß nicht, wofür er springen soll. Nicht die Götter treiben ihn, nicht die Natur ruft ihn. Nur das Versagen.
Er hatte es gewollt – das Wort, die Lehre, die Größe. Nun bleibt nur ein Rest aus Zweifeln und Lügen. Denn alle glauben an ihn, nur er selbst nicht. Sie bauen Altäre für seine Stimme, und er ist leer. Sie sehen in ihm die Verkörperung der Götter, und er fühlt nur das Nichts.
Und er, der Gottlose, der nicht einmal die Zerrissenheit in der eigenen Brust heilen kann, soll ihnen Götter geben? Wohl ihnen, dass sie seine Angst nicht kennen. Wohl ihnen, dass sie überhaupt noch glauben können, ganz gleich woran.
Vielleicht – ja vielleicht muss er sterben, damit ihr Glaube weiterlebt. Damit sie nicht sehen, dass ihre Säule aus Sand ist. Vielleicht muss er sich opfern, nicht für die Wahrheit, sondern für den Glauben, den sie brauchen.
Er senkt den Blick. Schwärze, Schatten, Stein. Kein göttliches Feuer, kein Grollen, kein Opferlicht. Nur ein schwarzer, stummer Schlund. Über ihm dagegen die Sterne, der Mond, zerrissene Wolkenbahnen: alles leuchtet – nur nicht der Abgrund.
Brennendes Feuer, entzündet, um Weltennacht zu erhellen,
Brennend das Herz, das noch schlägt: dann, wenn sonst keiner mehr glaubt.
Schöne Verse fürs Nachwort – doch Empedokles wird es nicht mehr schreiben. Er zieht die linke Sandale aus und legt sie ordentlich an den Rand. Ein Requisit. Die Nachwelt soll etwas finden. Die Kinder werden Flötenlieder darauf dichten, die Alten seufzen: „Er war zu groß für diese Welt.“ – und Empedokles möchte weinen – weil er all das nicht mehr hören wird.
Er beugt sich weit über den Rand. Doch da ist nichts. Kein Feuer, keine Glut. Nur Stein, Schatten, Leere.
»Ich bin kein Mensch, sondern ein Prinzip«, sagt er dem Ätna, der dazu schweigt. Wieder sieht Empedokles in das Dunkel hinab. Ein Prinzip – mit Höhenangst offenbar. Lächerlich.
Und plötzlich muss er lachen. Ein helles, absurdes Lachen, das der Wind fortträgt. Er wollte ein Gott sein im Leben – und kann es nicht. Er wollte ein Gott sein im Sterben – und kann es nicht. Er ist ein Heuchler, ein Zweifler, ein Lügner. Ein Mensch, der nicht den Mut hat, er selbst zu sein.
Doch eines ist er immer gewesen: ein Spieler. Und jedes Spiel hat er bis zum Ende gespielt. Das ist, was zählt.
Empedokles richtet sich auf. Er macht den entscheidenden Schritt – weg vom Abgrund. Wenn jeder Mensch zweimal stirbt – einmal im Körper, einmal im Gedächtnis der anderen – so wählt er den zweiten Tod. Der erste wäre ohnehin enttäuschend.
Eines Tages werden sie sterben, die Götter, in den Herzen der Menschen. Aber noch nicht heute. Er hat seinen Teil dazu getan.
Und so geht er singend den Pfad hinauf, durch die Nacht, durch die Berge, – fort.