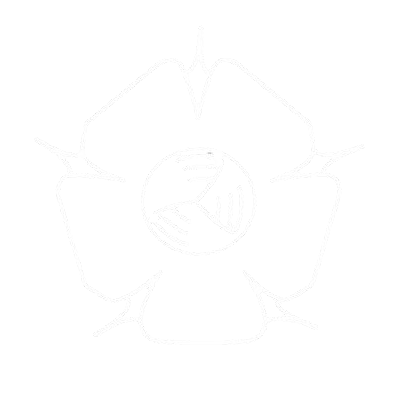Irgendwie bin ich nach Hause gekommen; und doch, wie wenn man zu lange zu Hause ist und einem die Decke auf den Kopf zu fallen droht, überkam mich nach der Lektüre das Gefühl, wieder wegzugehen, ins Freie, woanders hin: Es war gut, es ist vorbei … Weiter!
Buddenbrooks also. Ach ja, vor achtzehn Jahren habe ich das Werk gelesen, zum ersten Mal. Achtzehn Jahre. Was ich mir dabei neulich dachte: Angenommen, ich hätte damals ein Kind bekommen. Er oder sie wäre schon groß, erwachsen, hätte schon einen Führerschein, wäre selbst vielleicht über alle Berge. Achtzehn Jahre … Ich hatte damals mein Studium abgebrochen, saß allein im Haus in Tuurala, in Finnland, wollte mein Leben ändern, habe es geändert … Und ich war irgendwie zu diesem Buch gekommen. Las es. Und kann mich heute nur noch an Weniges erinnern: an die Szenen mit Hanno, in der Schule, am Ende … die trüben, nebligen Schulstunden, die Dunkelheit, die Beklemmung der sinnlosen Exerzitien, die düstere, feuchte Pflicht, die bürgerliche Stumpf- und Dumpfheit. Aber das Ganze, das ganze Konzept, die Konstruktion des Romans, sein Wirken und Weben – das ist mir völlig entfallen. Nun ja, achtzehn Jahre sind auch keine kurze Zeit.
Was soll ich empfinden? Melancholie? Verdruss? Leid? Reue? Was habe ich verpasst, was habe ich erreicht? Bin ich auch nur ein kleines Stückchen des Weges weitergekommen? Man wird es erst am Ende wissen …
Ach ja, die Buddenbrooks also: der Verfall der Familie. Das Ende ist doch zu grausam. Warum müssen auch alle, sogar der kleine Hanno, sterben? Nun ja, er ist es ja, der unter den Familienstammbaum den Strich zieht, von seinem Vater getadelt wird und meint, er habe dies getan in der arglosen Annahme, dass nichts mehr komme … Und so sollte es auch sein. Das ist das Tragische, wenn man so will, des Romans: Es sollte sich die Ahnung des kleinen Hanno bewahrheiten. Alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht …
Als ob Thomas Mann an diesen goetheschen Satz gedacht hätte? Wer weiß – vielleicht hat er es. Und es ist ja nicht wenig Wehmut, Schwere, Melancholie in diesem Roman. Thomas Buddenbrook, der Erbe des großen Kaufmannshauses: Wie sehr ich ihn jetzt erst verstehe! Und wie ich ihn beim Lesen bemitleiden musste! Er entdeckt Schopenhauer, er weint, er liest, er leidet, er steht kurz davor, sich zu befreien aus seinem elenden Leben, in das ihn eine immer stärker werdende Pedanterie, ein immer unerträglicherer Überdruss verstrickt. Und doch – nein: Tage später obsiegt über die Aufwallungen der Philosophie, die ihn vielleicht befreit hätte, der nüchterne Geist. Er legt den Schopenhauer weg, wendet sich wieder seinen Akten und seinem Geschäft zu, erleidet – so würde man das heute nennen – ein Burn-out, verfällt immer mehr in den Überdruss und in eine nur durch neurotische Zwänge erträglich zu machende Neurose … Es wird ihm ein Zahn gezogen. Und er stirbt.
In Lübeck geht das Gerücht, der große Buddenbrook sei am Zahnziehen gestorben, aber ach … Man weiß es als Leser besser: Er segnet das Zeitliche, weil ihm die Puste ausgeht, die Kraft, weil er nicht mehr kann, weil er keinen Sinn mehr sieht in seiner Arbeit und in den Bemühungen seiner Väter, die auf ihn gekommen sind wie eine goldene Last, wie ein vergoldeter Sarkophag, den zu dulden und zu tragen er keine Kraft mehr hat.
Die Zeiten ändern sich. Die Stearinkerzen werden vom Gas verdrängt. Das Gas von der Elektrizität. Und diese bringt mit sich einen neuen Unternehmergeist, neue Gewandtheit, Schlauheit, Bosheit … Die galanten Zeiten kaufmännischer Unternehmerkorrektheit sind vorbei. Jetzt legt man das Unterseekabel zwischen Europa und den USA. Man morst, man telegraphiert …
Hanno stirbt. Und irgendwann kommen die Zeiten, da das Radio aufkommt, der Fernseher, das Internet … Und alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht.
Wie klein und unbedeutend erscheint am Ende des Romans diese Welt der Kaufleute, wie bewundernswert behäbig, elegant und wichtig erschien sie zu Beginn des Romans. Ist dieser Roman also daher „gedacht“ als ein Emblem der Vergänglichkeit an sich? Ist dieser Roman ein Gleichnis, ein auf mehr als 700 Seiten aufgeblähtes Gleichnis dafür, dass alles, was wir Menschen tun, am Ende völlig sinnlos ist – und wir es trotzdem tun? Und unsere Ehre und unser Stolz gerade in diesem Trotzdem liegen?
„Sage, du habest uns hier liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl.“ Also: Auf Thomas Mann trifft das gewiss zu. Das Ethos des Künstlers: obwohl er weiß, dass alles vergehen wird und obwohl der Künstler weiß, dass alles, was er tut, ein Ablaufdatum hat, tut er es trotzdem. Das ist sein Glaube, das ist seine Religion. Das ist seine – Thomas Mann selbst hat sich dieses Wortes bedient – Frömmigkeit.
Die Buddenbrooks also: ein Roman der Frömmigkeit? Ein Roman des Glaubens? Vielleicht. Und die Pastoren, die darin vorkommen, die Pastoren mit ihren lächerlichen Halskrausen – müssen die nicht in ihrem salbungsvollen Dünkel erscheinen wie Karikaturen dieser eigentlichen, dieser wahren Frömmigkeit?
Kunst und Leben. Das ist der Gegensatz, der Thomas Mann zeit seines Lebens beschäftigt hat. Anders gesagt: Künstlichkeit und Echtheit. Es ist echt, trotzdem zu arbeiten, obwohl man weiß, dass alles den Bach runtergehen wird; und es ist künstlich, so zu tun, als habe das alles einen Sinn. Vielleicht ist auch das der Inhalt der Buddenbrooks: Es ist gleichsam ein Künstlerroman, ein Werk, in welchem der Autor sein eigenes Ethos schreibend ausprobiert und auf die Probe stellt: „Kann es mir gelingen, 700 Seiten lang durchzuhalten, obwohl ich weiß, dass es so enden wird?“
Ach, was kann man über die Buddenbrooks sagen, was nicht schon gesagt worden ist? Das Obige habe ich nun gesagt. Es ist ein seltsames Werk, denn es zieht sich zuweilen in die Länge. Manchmal passiert gar nichts; und das, was passiert, ist nicht immer unbedingt notwendig. Freilich: Am Ende ergibt alles irgendwie einen Sinn. Und nicht zu vergessen: immer dieselben Beschreibungen auch der nebensächlichsten Figuren. Jedem Charakter gebührt Ehre.
Rilke nannte das – sicherlich nicht unzutreffend – „einen Akt der Ehrfurcht vor dem Leben“: Jedes Detail wird berücksichtigt, auch wenn es nicht wirklich wichtig ist. Ein neues Kapitel beginnt; dann wird eine Figur lang und breit beschrieben, man meint als Leser, man habe es mit einer neuen wichtigen Person zu tun – aber weit gefehlt! Der Autor malt mit Worten. Und diese Worte sind in dem Roman reichlich entzückend, wohl gewählt; da findet das richtige Adjektiv das richtige, meist ein wenig lustig und ironisch angehauchte Substantiv. Und irgendwie ist man entschädigt dafür, dass es sich bei dem Beschriebenen nur um einen Nebendarsteller handelt, der kurz auftaucht und dann wieder verschwindet.
Vielleicht meinte Rilke also das mit der Ehrfurcht vor dem Leben: Noch der unwichtigste Charakter kommt zu seinem Recht. Irgendwie ist das nett, irgendwie liest sich das sehr gut und leicht … Und es macht jedenfalls, dass der Roman eine eigene, durchaus fesselnde Dreidimensionalität gewinnt, wie andere Romane dieser ermangeln.
Es ist traurig und schade, dass er vorbei ist. Es ist traurig, dass wir die skurrilen Oberlehrer, deren Schweißperlen auf der Stirn und deren sonderbare Eigenheiten körperlicher und seelischer Natur wir soeben beobachtet und liebgewonnen haben, wieder verlassen müssen; natürlich noch trauriger, dass wir Tony Buddenbrook verlassen müssen, die edle Schwester des Thomas, desjenigen, dem durch Schopenhauer ein kurzer Aufschwung des Geistes und der Seele beschert gewesen ist.
Man klappt das Buch zu. Und denkt sich: Ach ja, schade …!
Aber ja, natürlich hat der Roman Fehler – wenn man das denn so sagen darf. Die Szene etwa, in der die junge Tony den Sohn des Lotsenkommandeurs küsst. Das wäre der richtige Mann für ihr Leben gewesen, aber die Standesdünkel haben ihr die Ehe nicht gestattet. Stattdessen heiratet sie einen betrügerischen Psychopathen, der sich finanziell ruiniert. Danach einen schwerblütigen Mann aus Bayern, der sie kompromittiert. Und sie endet als eine Frau, „die das Leben gekannt hat“. Na, immerhin.
Aber wie schön, wie wahr ist es, wie Thomas Mann das beschreibt: Wenn der Mensch seinem Herzen nicht folgt, wird er unglücklich. Natürlich steht das in jedem Glückskeks, und man kann es als aufmunternden Spruch auf WC-Papierrollen lesen. Aber ist es darum weniger wahr?
Die Aufgabe des Romans, der Erzählung, ist es, diese Wahrheit zum Leben zu erwecken. Und wie erweckt man etwas am ehesten zum Leben als durch Liebe? Und Liebe zu seinen Figuren hat der junge Autor zu Genüge gehabt, oh ja … Da kann man etwas lernen.
Nun denn: erstaunlich sind die Buddenbrooks allemal, ebenso erstaunlich wie Die Gleichgültigen von Moravia – weil es sich bei diesen beiden Büchern um umfangreiche Hervorbringungen sehr junger Menschen handelt. Um Autoren, die kaum 23 waren, als sie zur Sache gingen … Und woher wussten sie das alles, was sie da schrieben?
Man selber – ich also – fragt sich: Hätte ich all diese Dinge gewusst mit 23? Hätte ich so eine Einsicht ins Leben gehabt? Und man muss sich eingestehen: eigentlich nicht. Und sobald man sich das eingesteht, wird man irgendwie traurig und fragt sich, warum man das eigene Leben so verpfuscht hat. Habe ich es verpfuscht? Geht es mir wie Thomas Buddenbrook: dass ich hoffe und arbeite, aber nichts erreiche? Geht es mir wie Tony Buddenbrook: dass ich lebe und leide und nichts von all dem übrig bleibt?
Romane, die einem lebendige Menschen zeigen, haben die Angewohnheit, einen Nachgeschmack der Melancholie zu hinterlassen. Warum? Nun, weil man über das eigene Leben anders nachzudenken geradezu gezwungen wird. Man sieht klarer, man sieht mehr, genauer … Und denkt sich: Ach ja, achtzehn Jahre! Kinder, wie die Zeit vergangen ist!
„Tony … sie war nicht glücklich“, heißt es an einer Stelle im Roman, „sie empfand Langeweile und ärgerte sich über die Pastoren und Missionare.“ Geht es einem nicht manchmal selber ähnlich?
„Im Laufe der Jahre hatte seine Pedanterie zugenommen“, heißt es an anderer Stelle über ihren Bruder Thomas Buddenbrook. Nein, es sind keine glücklichen Erdenkinder, diese Buddenbrooks. Aber der Autor muss glücklich genug gewesen sein, dieses Werk zu beginnen und fortzuführen.
In einer großen Szene – eigentlich möchte man sagen: fast der einzigen wirklich großen, sich zu dostojewskischen Ausmaßen steigernden Szene, nämlich dem Streit zwischen dem sich pedantisch zwingenden Realisten Thomas und seinem zum Lotterleben neigenden Bruder Christian, der eigentlich nur deshalb ein Lotterleben führt, weil seine Nerven zu reizbar sind – sagt Christian:
„Du hast dir einen Platz im Leben erobert, eine geehrte Stellung, und da stehst du nun und weisest kalt und mit Bewusstsein alles zurück, was dich einen Augenblick beirren (…) könnte, denn das Gleichgewicht, das ist dir das Wichtigste. Aber es ist nicht das Wichtigste, Thomas, es ist vor Gott nicht die Hauptsache! Du bist ein Egoist, ja, das bist du!“
Das schreibt der junge Thomas Mann. Und blicken wir auf sein Leben: Hat er selber denn anders gehandelt als dieser Thomas Buddenbrook, dem der Bruder Egoismus vorwirft? Nein, hat er nicht. Er hat seinem Werk und seinem Schaffen alles untergeordnet: seine Ehe, seine Familie, sein Leben. Und doch wusste er schon so früh – hätte er diese Worte denn sonst Christian in den Mund legen können? –, dass das Gleichgewicht nicht alles ist; dass es im Leben auch um etwas anderes geht. Ja, wesenhaft um etwas anderes.
Um was denn? Um Liebe, Gemeinschaft, Mitleid und Herzensgüte. Doch die dem Werk Verpflichteten haben Angst. Sie haben Angst, sich der Liebe zu öffnen, weil die Liebe Zeit und Kräfte vergeudet. Sie haben Angst, Mitleid zuzulassen – so wie Thomas seinem Sohn Hanno gegenüber –, weil dies hieße, dass sie ihr Leben ändern müssten, sobald sie erkennen würden, warum ihr Gegenüber leidet. Und sie haben Angst, sich der Güte zu verschreiben, weil die Güte, so wie die Liebe, die Gefahr mit sich zu bringen scheint, die Zeit zu fressen … die kostbare Zeit, der alle nachlaufen, der der Künstler ebenso nachläuft wie der Kaufmann, der seine Geschäfte machen und seine Konkurrenten überrumpeln will.
Und wie man ihr auch nachläuft, man wird sie nicht erfassen. August von Platen hat es – Thomas Mann verehrte auch ihn – in seinem berühmten Sonett ziemlich klar ausgesprochen. Wie man sie auch zu nutzen beabsichtigt: Wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Wenn nicht der Segen Gottes auf den Dingen liegt, dann werden sie nicht geschehen.
Und so lag denn der Segen Gottes nicht auf dem Hause Buddenbrook, und es musste verenden. Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen, gepriesen sei der Name des Herrn.
Das Kaufmannsschild auf dem Hause Buddenbrook wird ersetzt durch ein andres Schild, denn das Haus wird verkauft. Hanno stirbt am Ende und nichts vom alten Glanze bleibt bestehen. Ach, hätten sie doch mehr dem Leben vertraut! Hätten sie sich doch mehr gehen lassen! Hätten sie doch nicht, so wie Tony, steif und angespannt, auf Ehre und Ruhm geachtet! Wären sie bloß ihrem Herzen gefolgt. Sie wären glücklicher geworden. Der Verfall der Buddenbrooks ist auch ein Abbild, ein Gleichnis des Verfalls des Menschen, der sich dem Geiste verschreibt: Kann man glücklich sein und dem Geiste dienen? Thomas Mann hat seiner Frau in einem Brief geschrieben: dass er nicht eigentlich nach dem Glücke trachte, sondern nach seinem Werk. Kann man beides haben? Kunst und Leben? Leben und Kunst? Diese Frage – es wäre lächerlich, das Gegenteil zu behaupten – „hat“ Thomas Mann nicht von Nietzsche. Nein, es ist eine Frage, die sein eignes Leben ihm schmerzlich gestellt hat. Der Autor ist zu Ruhm gelangt. Doch ist er jemals glücklich gewesen? Vielleicht müssen wir uns Hanno als glücklichen Menschen vorstellen: weil er am Ende stirbt. Vielleicht ist es ja am Ende – doch ein gutes Ende? Alles löst sich auf und zerfließt im Flusse der Zeit? Hat Gott es denn nicht mit uns allen so vor?
Buddenbrooks: Vor achtzehn Jahren habe ich das Werk zum ersten Mal gelesen. Ich saß im Sommer auf der Veranda des Hauses; ich kann mich nur vage noch erinnern …. Und dass dieses Werk mir – eine Zeitlang – zu einem schmerzlichen Maßstab geworden ist. Es war seltsam, fast befremdlich, es wieder zur Hand zu nehmen; momentweise habe ich das Rauschen der Birkenblätter, das Glitzern des Flusses vorm Haus wieder gesehen; und mein altes, mein damaliges Ich: einsam, unwissend, unglücklich und verloren …. Für einen Moment empfand ich wieder, was ich damals empfunden habe: Dass alles irgendwie noch beginnen müsse. Ach, was war ich denn für ein unreifer, unerfahrener, dummer, an irgendwelchen idiotischen Idealen klebender Mensch damals! Es war gut, diesen Roman wieder zu lesen, als neuer Mensch, nach achtzehn Jahren: „Er hatte wieder empfunden, wie wehe die Schönheit tut, wie tief sie in Scham und sehnsüchtige Verzweiflung stürzt und doch auch den Mut und die Tauglichkeit zum gemeinen Leben verzehrt.“ – So heißt’s über Hanno, recht schon gegen Ende des Romans. Das war ich, mein altes Ich …. !
Man kann dankbar sein, dass man trotzdem gelebt hat; dass es einem – anders als dem Thomas Buddenbrook – gelungen ist, den Überdruss zu überwinden. So oder so: wozu leiden, wenn man das Leiden aufheben kann? Es ist eine einfache Frage; so einfach, dass sie – für die meisten – schon viel, viel zu schwer zu beantworten ist. Die Buddenbrooks müssen an dieser Frage scheitern und zerbrechen. Gebe der Allmächtige, dass wir Leser an ihr nicht zuschanden werden, Amen!