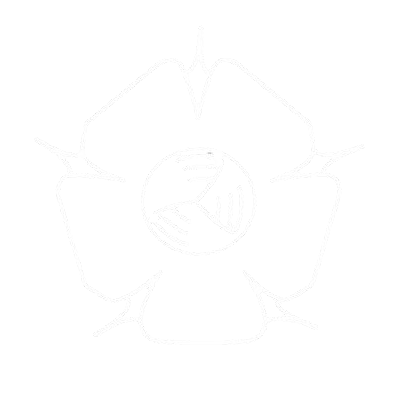Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz; wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander.
Genesis 22, 7-8
Bekanntlich hat man Johannes Chrysostomos aufgrund seiner flammenden Reden wider die Sünden des Reichtums und der Verschwendungssucht, in denen er sich besonders gegen die byzantinische Kaiserin Aelia Eudoxia richtete, unter Mithilfe des Patriarchen Theophilos und der anderen Bischöfe mit Waffengewalt aus Konstantinopel verbannt und zum Exil in den entlegensten Teil Anatoliens im Taurus-Gebirge geschickt. Chrysostomos aber hörte selbst dort nicht auf, aus der Verbannung Briefe an seine Freunde und an die Gemeinden zu schreiben. In dem Brief an den gefallenen Theodorus lesen wir: „Denn auf mir lastet nun nicht ein solches Leid, dass mir das Übermaß der Trauer eine Rüge zuziehen könnte; sondern ein solches, um dessentwillen auch ein Petrus oder ein Paulus ohne Scheu weinen und trauern und jeden Trost verschmähen würden.“ Chrysostomos verzweifelte nicht über sein eigenes Los, nicht über seine Verbannung in die anatolische Einöde, sondern über den Fall seines lieben Freundes Theodorus.
Die Verfolgung und die Vertreibung, die tiefe Einsamkeit im Exil, haben den Glauben, den Chrysostomos auf dem langen Fußmarsch immer in sich trug, nicht erschüttern können. Vielleicht war es auch so, dass er sich, je mehr er den Menschen entwuchs, umso tiefer der Wüste und der Stille, die über ihr liegt, verwandt fühlte. Immer entsteht der Glaube dort, wo die Worte aufhören, wo ein plötzliches Einvernehmen besteht, zwischen der Seele und Gott, in dem nichts mehr gesagt werden muss: Was aber geschieht an einem Menschen, der sich auf diesem äußersten Punkt befindet, der Glaube ist und ganz und gar Glaube? Als Kierkegaard, sehr, sehr lange nachdem Chrysostomos lebte und starb, über diesen Zustand schrieb, schrieb er über ihn als „Bewegung“ – und als Sprung.
Dem dänischen Sonderling waren das eigenbrötlerische Sola Gratia und besonders das Sola Fide des deutschen Sonderlings Martin Luther nicht gut bekommen; Denn diese Gedanken waren unfassbar fest, erschreckend fest in seine Seele eingefahren, hatten ihn für die Welt verdorben, so dass er nur mehr das unbändige, willensmächtige Wort von Entweder-Oder für seine Philosophie wählen konnte. Und noch dazu, vielleicht noch viel schlimmer für ihn: Der „garstige, breite Graben“, welchen Lessings Schriften ihm vor seinem geistigen Auge heraufbeschworen, auch dieser ließ ihn sich nicht nach links noch nach rechts wissen. Was bleibt einem denkenden Menschen also zu tun übrig, wenn die allgemeine, oder die historische, oder die empirische, oder die notwendige „Wahrheit“ ihn von der Offenbarung, von Gott trennt? – Und um diese Frage zu beantworten verlangte Kierkegaard Entsetzliches von jedem Einzelnen, indem er es auch von sich selbst verlangte, die Entsetzlichkeit seiner Forderung in- und auswendig kennend. Er verlangte den Sprung. Er verlangte, dass der Mensch sich vom festen Boden unter seinen Füßen los löse, dass er nichts mehr kennen sollte außer den Sprung, dass er Kraft des Absurden, den Glauben in die Welt trage.
Dieser Mensch wird dann ein Rufender sein, obwohl er sich nicht zu verständigen weiß, noch braucht, denn niemand wird seine Worte verstehen können: Ein durch die Wüsten Gehender, selbst wenn er unter Menschen ist, den kein irdischer Schritt näher zu seiner Heimat tragen könnte, gleichgültig wohin er auch geht. In der Stille des abessinischen Hochlandes, weit oben auf einem Felsen, haben die Männer, welche dort lebten und starben, vor vielen Jahrhunderten Stein an Stein gereiht, um ein Kloster zu bauen. Es führt zu diesem Kloster nur ein einziger Weg: Über ein Seil, das an einer steilen Felswand nach oben geht. Dieses Seil ist Gott. An diesem Seil aber zu klettern, das kann nur der Mensch tun. Nur er kann die Hand nach dem Seil ausstrecken, sich an ihm nach oben ziehen. Ohne die Hilfe eines anderen muss er allein die Bewegung machen. Tut er das nicht, sucht er bei jemandem nach Halt, dann streckt er die Hand ins Nichts, und wird in den Abgrund fallen, der sich unter dem „festen Boden“ versteckt gehalten hat.
Nur das Seil wird ihn nicht täuschen, wenn er bloß zu ihm springen kann. Der Sprung bedeutet auch: Keine einzelne Seele kann so sehr von Gott verlassen sein, dass ihr der Sprung nicht gelingen könnte. Der Sprung, so unbegreiflich schwierig, so entsetzlich er erscheinen mag, kann nur dann gelingen, wenn er vom Einzelnen, ohne Hilfe eines anderen Menschen, vielleicht sogar, für den kurzen Augenblick des Abspringens, selbst ohne die Hilfe Gottes, aus sich selbst heraus gemacht wird. Gott ist Grund, Sinn und Ziel des Sprungs, aber die Bewegung bleibt dem Menschen überlassen, kann nur aus „unendlicher Resignation“, wie Kierkegaard schreibt, gemacht werden, wenn es zwischen dem Willen des Menschen und dem Willen des Herrn keinen Unterschied mehr gibt: Denken wir an Hiob in seiner Verzweiflung und an Jakob am Fluss Jabbok – Sie stritten mit Gott, und wussten doch noch nicht, dass sie auch darin seinen Willen taten.
Der Glaube ist der Sprung, in dem man nicht fallen kann. Wer springt, der wird sehen, dass auch der Boden unter seinen Füßen, den manche „Welt“ nennen, nichts sonst war als der schreckliche Graben Lessings. Die Welt ist aber etwas ganz anderes, und zu dem Wort, das in sie kam, ist es nicht möglich sich objektiv zu verhalten: Immer ist die Botschaft nur für den bestimmt, der nicht anders kann, als sie zu hören. Und nur dann, wenn er gehört hat, mit eigenen Ohren gehört, wird die Welt ihm werden, was sie ist, und ohne dass es einen Graben gibt. Nicht über den Graben zu kommen, weil man fürchtet, in ihn hineinzufallen, aber ohne zu merken, dass man längst fällt, und an der Furcht gestorben ist, ist tragisch, aber den Sprung zu machen, obwohl man allein ist, nicht weiß, wohin der Sprung führt, und doch nicht zu fallen, ist paradox – und das ist der Glaube.
Über das Hochland von Abessinien, über das einsame Kloster Debre Damo und über das Taurus-Gebirge Anatoliens zieht der Wind genauso hinweg wie über die Hausdächer Kopenhagens und über die Schlosskirche von Wittenberg. Langsam und beständig zieht er über alles, das in der Welt ist, hinweg und mit sich bringt er die Zeit. Oder vielleicht ist es die Zeit, die ihn mit sich bringt? Und langsam und beständig wehen sie alles und alle um, der Wind und die Zeit. Nur manche, wahrscheinlich ganz wenige – umso kleiner sie sind, desto leichter – fangen die beiden auf, und sie treiben sie nach oben. Die aber können nicht fallen, und deshalb leben sie ewig.