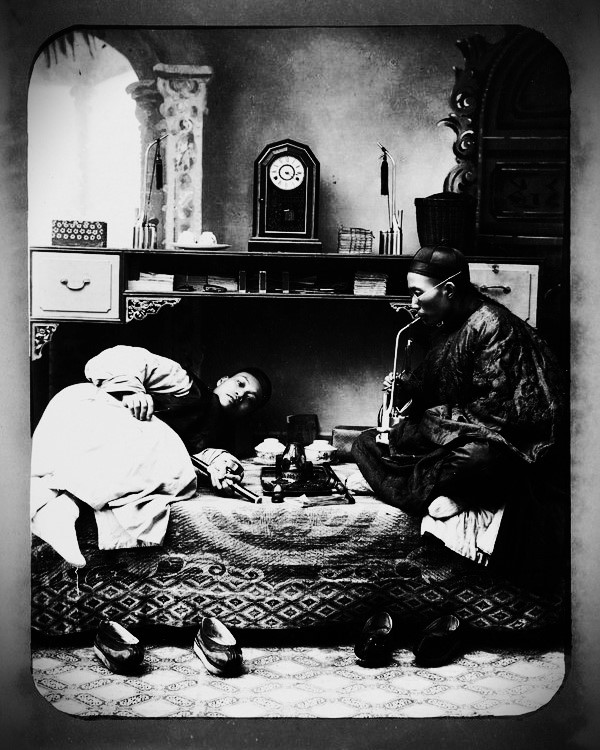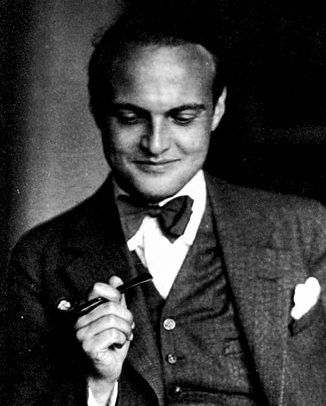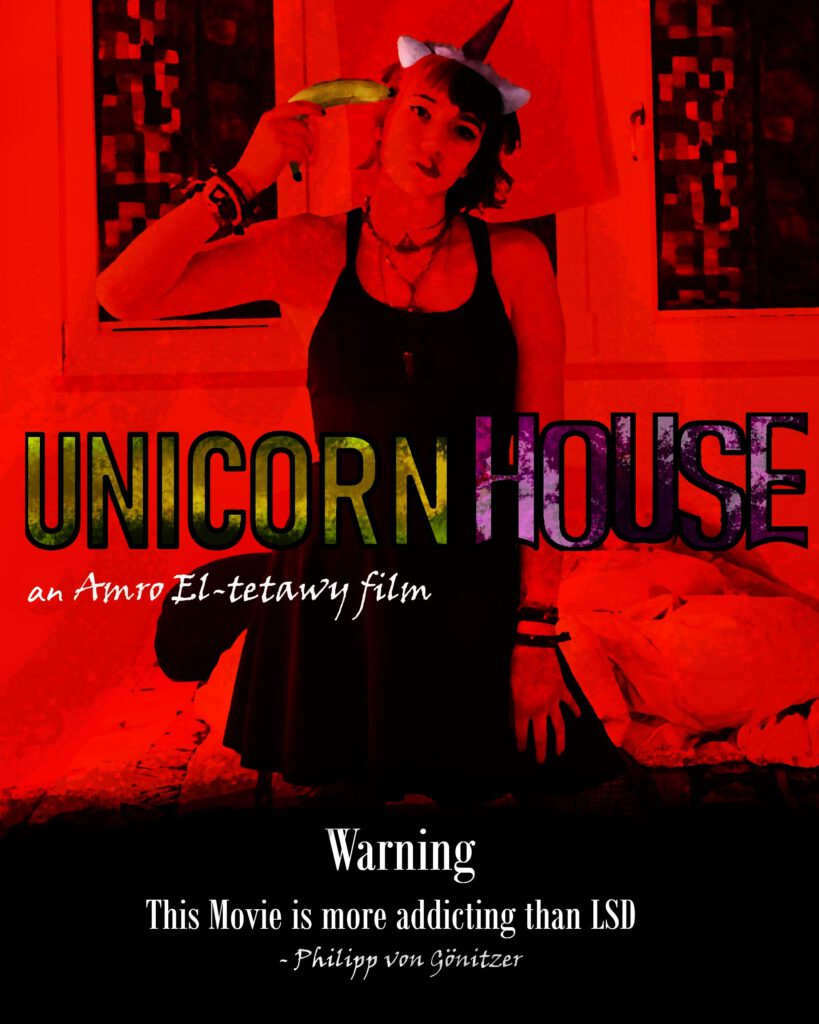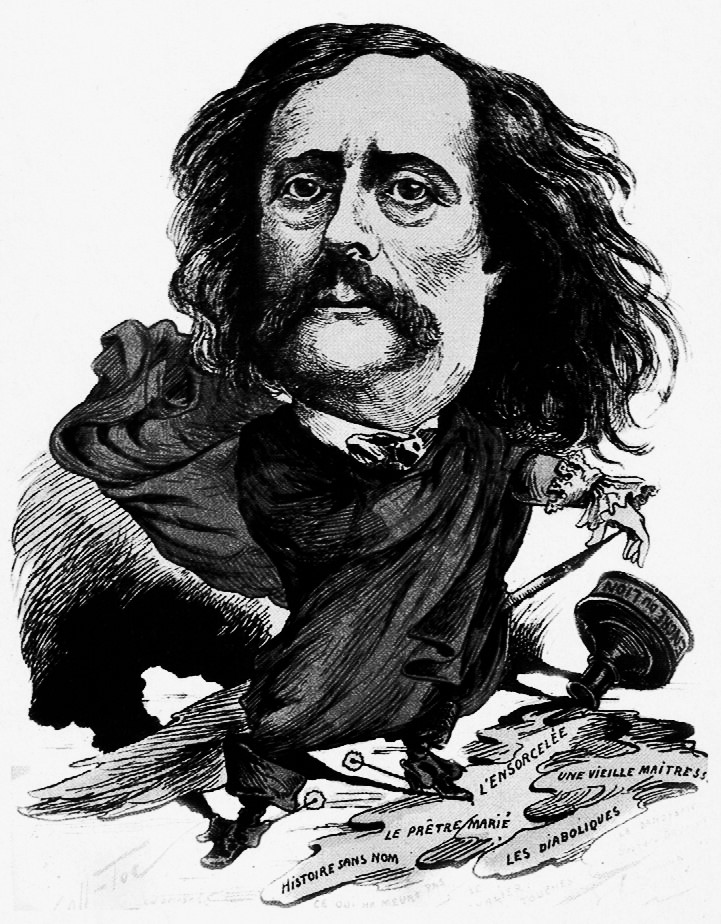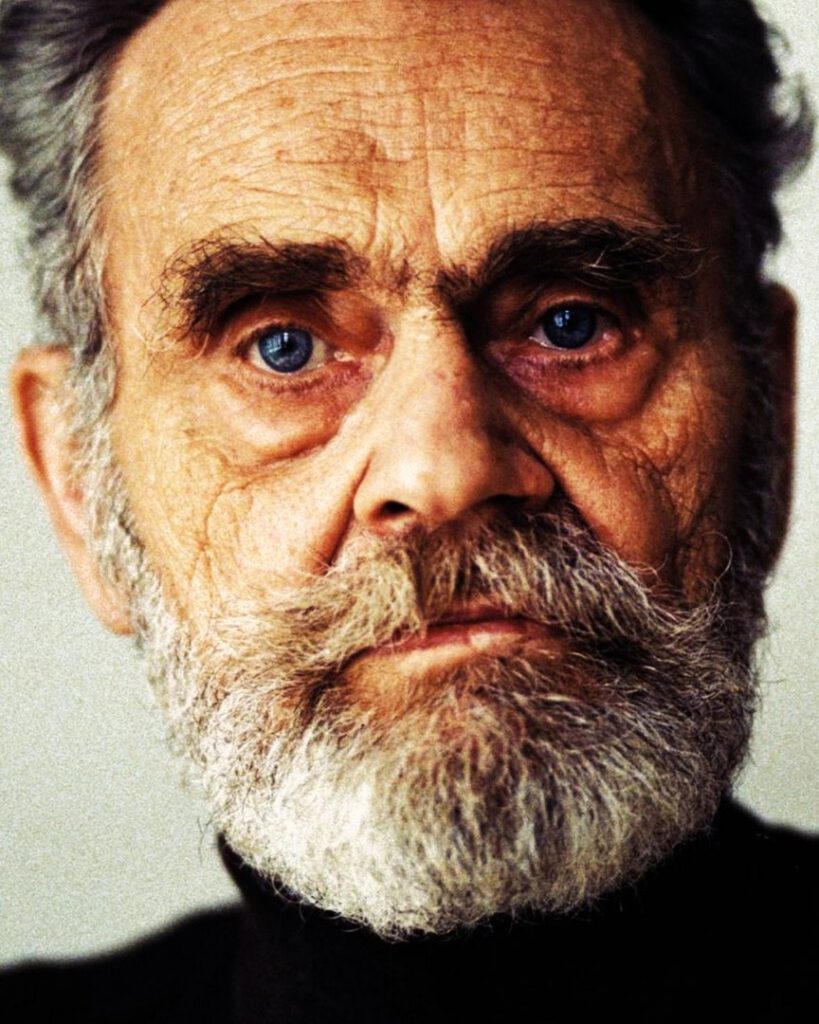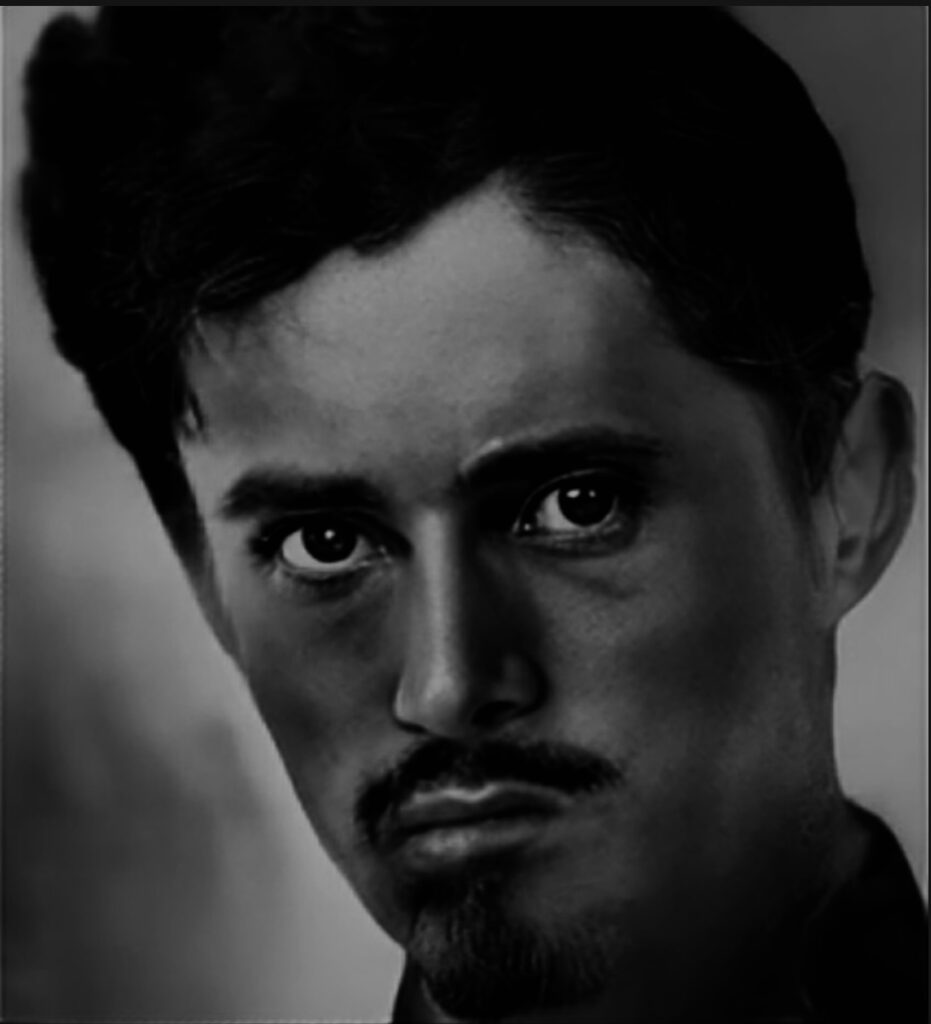Als Bergende erfährt die Kunst Entlastung. Es obliegt ihr nicht länger, die Arbeit der Politik zu übernehmen, wenn diese sich dem Nachdenken über die eigenen Grundlagen oder dem ihr genuinen Handeln verweigert. Bergende Kunst ist eine, die vom Auftrag, Staatsgebilde zu gründen, entbunden ist. Die Grundlegung politischer Gemeinschaften wird der Kunst zwar immer wieder angetragen, aber sie kann solche Stiftungsfunktion nicht erfüllen. Der Staat geht nicht aus ästhetischem Handeln hervor.
Carl Schmitt hat die Hoffnung der romantischen Generation auf einen politischen Gründungsakt aus dem Geist der Ästhetik analysiert und verworfen. Politisches Handeln und ästhetisches Schaffen widerstreben einander. „Jede politische Aktivität—mag sie nur die Technik der Eroberung, Behauptung oder Erweiterung politischer Macht zum Inhalt haben oder auf einer rechtlichen oder moralischen Entscheidung beruhen—widerspricht nämlich der wesentlich ästhetischen Art des Romantischen. (…) Weil der konkrete Punkt, um den sich der romantische Roman bildet, immer nur occasionell ist, so kann Alles romantisch werden, und in einer solchen Welt lösen sich alle politischen oder religiösen Unterscheidungen auf in eine interessante Vieldeutigkeit. Der König ist eine romantische Figur wie der anarchistische Verschwörer und der Kalif von Bagdad nicht weniger romantisch als der Patriarch von Jerusalem. Hier läßt sich Alles mit Allem vertauschen.“ (Politische Romantik, 164)
Auch Antonio Gramsci ist Romantiker in Schmitts Sinn. Die Appropriation des Marxisten durch die Konservativen ist nicht strategisch, sondern philosophisch falsch. Hegemonie, so Gramsci, ist Herrschaft nicht primär durch Zwang, sondern durch Konsens. Der wird geschaffen und gehegt durch die Institutionen der Zivilgesellschaft. Der Kulturapparat garantiert bessere Kontrolle als die Staatsmittel der Unterdrückung. So sieht es bereits Karl Marx, für den die herrschenden Gedanken stets die Gedanken der herrschenden Klasse sind. Gramsci fordert die Intellektuellen und Künstler der Arbeiterklasse dazu auf, eine Gegenhegemonie zu schaffen. Hegemonie gegen Gegenhegemonie: es kommt zum guerra di posizione, zum Krieg der Positionen. Die Obsession mit dem gegenhegemoniellen Sieg verklärt diesen bereits zur Ergreifung der politischen Macht. Kulturelle Avantgarde de-metaphorisiert sich selbst. Der Kulturkampf ist nicht deshalb falsch, weil er längst zum Grabenkrieg verkommen ist. Sondern die unhintergehbare ästhetische Multivalenz steht der Entschlossenheit der politischen Tat entgegen.
Es existiert jedoch eine Konfusion hinsichtlich der politischen Rolle des Ästhetischen. Sie resultiert daraus, dass nicht unterschieden wird zwischen einer konstitutiven und einer bergenden Rolle der Kunst. Es gibt jedoch keinen Grund, die bergende Funktion der Kunst für den Staat zu verwerfen, wie Schmitt es tut. Der Kunst dagegen politisch konstitutive Macht zuzuschreiben, bedeutet hingegen, das eigentlich politische Handeln zu entmachten.
So irrt Martin Heidegger, wenn er die Kunst damit betraut, für ein Volk die Gründung seines Staatswesens zu übernehmen. „Die Dichtung ist die Sage der Unverborgenheit des Seienden. Die jeweilige Sprache ist das Geschehnis jenes Sagens, in dem geschichtlich einem Volk seine Welt aufgeht und die Erde als das Verschlossene aufbewahrt wird. Das entwerfende Sagen ist jenes, das in der Bereitung des Sagbaren zugleich das Unsagbare als ein solches zur Welt bringt. In solchem Sagen werden einem geschichtlichen Volk die Begriffe seines Wesens, d. h. seiner Zugehörigkeit zur Welt-Geschichte vorgeprägt. (…) Immer wenn Kunst geschieht, d. h. wenn ein Anfang ist, kommt in die Geschichte ein Stoß, fängt Geschichte erst oder wieder an. Geschichte meint hier nicht die Abfolge irgendwelcher und sei es noch so wichtiger Begebenheiten in der Zeit. Geschichte ist die Entrückung eines Volkes in sein Aufgegebenes als Einrückung in sein Mitgegebenes.“ (Kunstwerk, 61/63)
Erst durch die Kunst wird ein Volk politisch und geschichtlich, so argumentiert Heidegger. Erst durch die Dichtung konstituiert es sich als ein staatlich verfasstes. Zwar spricht Heidegger an anderen Stellen, u. a. in seiner Rektoratsrede, von der „staatsgründenden Tat“, aber diese erscheint letztlich als schwacher Nachhall der ästhetischen Aktion.
Die Wurzel für diesen Versuch, die Kunst als staatskonstituierende Kraft einzusetzen, liegt in Kants Bestreben, ästhetische Rezeption aus der Isolation herauszuführen. Da das ästhetische Urteil nicht allgemein verbindlich sein kann, weil die ästhetische Erfahrung nicht unter einen Begriff zu subsumieren ist, steht die Gefahr des Subjektivismus im Raum. Dieser entkommt Kant, indem er die Gemeinschaft zum Prüfstein des ästhetischen Urteils macht. Ein Einzelner kann nicht entscheiden, ob etwas schön ist. Er muß es anderen zur Diskussion vorlegen. „Das Geschmacksurteil selber postuliert nicht jedermanns Einstimmung (denn das kann nur ein logisch allgemeines, weil es Gründe anführen kann, tun); es sinnet nur jedermann diese Einstimmung an, als einen Fall der Regel, in Ansehung dessen er die Bestätigung nicht von Begriffen, sondern von anderer Beitritt erwartet.“ (KdU, A / B 26)
Nach einer Begegnung mit dem Schönen sind wir genötigt, die Gesellschaft anderer aufzusuchen. Wir brauchen ihre Bestätigung dafür, dass das, was wir erfahren haben, tatsächlich schön war. Dieses Zusammenrufen der Gemeinschaft hat für Kant konstituierende Bedeutung. Die Zivilisation erhebt sich aus der Diskussion des Schönen. Ganz im Einklang mit den politischen Vertragstheorien der Aufklärung setzt Kant das Schöne sogar als Manifestation des Gesellschaftsvertrags ein.
„Für sich allein würde ein verlassener Mensch auf einer wüsten Insel weder seine Hütte, noch sich selbst ausputzen, oder Blumen aufsuchen noch weniger sie pflanzen, um sich damit auszuschmücken; sondern nur in Gesellschaft kommt es ihm ein, nicht bloß Mensch, sondern auch nach seiner Art ein feiner Mensch zu sein (der Anfang der Zivilisierung): denn als einen solchen beurteilt man denjenigen, welcher seine Lust andern mitzuteilen geneigt und geschickt ist, und den ein Objekt nicht befriedigt, wenn er das Wohlgefallen an demselben nicht in Gemeinschaft mit andern fühlen kann. Auch erwartet und fordert ein jeder die Rücksicht auf allgemeine Mitteilung von jedermann, gleichsam als aus einem ursprünglichen Vertrage, der durch die Menschheit selbst diktiert ist.“ (B 163 / A 162)
Es ist nur ein kleiner Schritt von hier bis zur Deklaration, dass der gesellschaftliche Vertrag auf einer gemeinsamen ästhetischen Erfahrung eines Volkes beruht. Heidegger macht diesen Schritt. Ästhetische Rezeption gründet Geschichte: „Die Bewahrung des Werkes vereinzelt die Menschen nicht auf ihre Erlebnisse, sondern rückt sie ein in die Zugehörigkeit zu der im Werk geschehenden Wahrheit und gründet so das Für- und Miteinandersein als das geschichtliche Ausstehen des Da-seins aus dem Bezug zur Unverborgenheit.“ (Kunstwerk, 54)
Für Walter Benjamin ist es völlig klar, worauf eine Theorie der Ästhetik als staatskonstituierender Kraft hinausläuft. Im Nachwort zu seinem Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ schlußfolgert er: „So steht es um die Ästhetisierung der Politik, welche der Faschismus betreibt.“ (599)
Benjamin schüttet das Kind mit dem Bade aus. Es gibt sehr wohl ästhetische Aspekte der Politik, die sogar essentiell sind, ohne faschistisch zu sein, aber es sind nicht die der Gründung. Es sind die der Bergung.
Das Alte Testament markiert deutlich den korrekten Zeitpunkt dafür, Volk und Ästhetik zusammenzuführen. Es ist nicht der Moment der politischen Konstitution der Gemeinschaft. Kurz nachdem Gott das Volk Israel aus seiner ägyptischen Verknechtung geführt hatte, erscheint er ihm, um mit ihm einen Bund zu schließen. In der Wüste Sinai beruft Gott Mose auf den Berg desselben Namens. Unter Donner und Blitz und zum großen Schrecken des auf Abstand gehaltenen Volkes übermittelt Gott Mose die Zehn Gebote. Dies ist der Augenblick, in dem Gott mit seinem auserwählten Volk einen Bund schließt. Mit dem Eintritt in diesen Bund tritt Israel in sein Eigenes ein. Es konstituiert sich in diesem Akt des geheiligten Empfangens als das von dem einzigen Gott geleitete Volk. Abgesehen von einem unerträglich lauten Posaunenton fehlen dieser Bündnisschließung und Volkwerdung alle ästhetischen Elemente. Kurz darauf aber wird das Ästhetische als unabdingbar für den Bund hinzugezogen. Unabdingbar nicht für dessen Etablierung, sondern für dessen Aufrechterhaltung. Der Bund Gottes mit dem Volk Israel wird ästhetisch geborgen.
In einer zweiten Offenbarung erhält Mose detaillierte Anweisungen für den Kultus und Ritus. Für beide sind ästhetisch geformte Objekte zentral. Stiftshütte, Bundeslade, ein Tisch für die Schaubrote, ein siebenarmiger Leuchter, der Brandopferaltar—bevor die tägliche Anbetung praktiziert werden kann, müssen erst einmal all diese Prachtobjekte nach genauesten Vorschriften angefertigt werden. Ein Beispiel: „Du sollst auch einen Leuchter aus feinem Golde machen, Fuß und Schaft in getriebener Arbeit, mit Kelchen, Knäufen und Blumen. Sechs Arme sollen von dem Leuchter nach beiden Seiten ausgehen, nach jeder Seite drei Arme. Jeder Arm soll drei Kelche wie Mandelblüten haben mit Knäufen und Blumen.“ (2. Mose 25, 31-33)
Im alltäglichen Kultus erneuert sich der Bund des Volkes Israel mit seinem Gott genau wie sich das Volk in diesem Ritus als Gemeinschaft erneuert. Für diese Erneuerung ist das Ästhetische unverzichtbar. Das ästhetische Objekt birgt den Bund. Gott weist Mose an, die Tafeln mit den Gründungsgeboten in die prächtige Bundeslade zu legen. „Und du sollst den Gnadenthron oben auf die Lade tun und in die Lade das Gesetz legen, das ich dir geben werde. Dort will ich dir begegnen, und vom Gnadenthron aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubim will ich mit dir alles reden, was ich dir gebieten will für die Israeliten.“ (2. Mose 25, 21-22) Der ästhetisch geborgene Gott spricht zu seinem Volk. Das Volk Gottes bleibt Volk durch diese Ansprache aus der Schönheit.
Auch das griechische Denken sieht das Schöne beteiligt am Gedeihen des Staates. Schönheit entfesselt Liebe, die zu Einzelnen wie die zur Polis. Ohne eine solche emotionale Zuwendung kann ein Gemeinwesen nicht florieren. In Platons Gastmahl führt Phaidros aus: „Denn was diejenigen in ihrem ganzen Leben leiten muß, welche schön und recht leben wollen, dieses vermag weder die Verwandtschaft ihnen so vollkommen zuzuwenden noch das Ansehen, noch der Reichtum, noch sonst irgend etwas als die Liebe. Was meine ich aber hiermit? Die Scham vor dem Schändlichen und das Bestreben nach dem Schönen. Denn ohne diese vermag weder ein Staat noch ein einzelner große und schöne Taten zu verrichten.“ (178 d) Der Staat wird gestützt durch die Schönheit, aber nicht gegründet.
Gerade in Zeiten der Anfechtung birgt die Kunst das, was ein Gemeinwesen ausmacht. Sie bewahrt die Erinnerung an das politisch Eigene. Gleichwohl existiert stets die Versuchung, von der bergenden Funktion überzugehen zur Gründungstat. Es ist diese Funktionsverschiebung, die die Griechen Hybris nennen würden. Das Gleiten von der Bergung zur ästhetischen Staatsgründung läßt sich in Stefan Georges Gedicht „Der Dichter in Zeiten der Wirren“ mitverfolgen. Dessen letztes Drittel lautet:
Der Sänger aber sorgt in trauer-läuften
Dass nicht das mark verfault . der keim erstickt.
Er schürt die heilige glut die über-springt
Und sich die leiber formt . er holt aus büchern
Der ahnen die verheissung die nicht trügt
Dass die erkoren sind zum höchsten ziel
Zuerst durch tiefste öden ziehn dass einst
Des erdteils herz die welt erretten soll . .
Und wenn im schlimmsten jammer lezte hoffnung
Zu löschen droht: so sichtet schon sein aug
Die lichtere zukunft. Ihm wuchs schon heran
Unangetastet von dem geilen markt
Von dünnem hirngeweb und giftigem flitter
Gestählt im banne der verruchten jahre
Ein jung geschlecht das wieder mensch und ding
Mit echten maassen misst . ds schön und ernst
Froh seiner einzigkeit . vor Fremdem stolz .
Sich gleich entfernt von klippen dreisten dünkels
Wie seichtem sumpf erlogner brüderei
Das von sich spie was mürb und feig und lau
Das aus geweihtem träumen tun und dulden
Den einzigen der hilft den Mann gebiert . .
Der sprengt die ketten fegt auf trümmerstätten
Die ordnung . geisselt die verlaufnen heim
Ins ewige recht wo grosses wiederum gross ist
Herr wiederum herr . zucht wiederum zucht . er heftet
Das wahre sinnbild auf das völkische banner
Er führt durch sturm und grausige signale
Des frührots seiner treuen schar zum werk
Des wachen tags und pflanzt das Neue Reich.
Der Dichter bewahrt die Hinterlassenschaft der Ahnen und erweckt sie zu neuem Leben. Aber George läßt es nicht damit bewenden, dass der Sänger ein Erbe bewahrt. Sondern er will eine überlieferte Verheißung aktualisieren: ein Mann soll die Not der Zeit überwinden und ein Neues Reich stiften. Aus einer Ästhetik der Bergung wird eine Ästhetik der Gründung.
Was George klar erkannt hat, ist die Notwendigkeit, das Gemeinwesen ästhetisch zu bergen. Nicht nur in Zeiten der Not. Der von Jürgen Habermas vertretene Verfassungspatriotismus ist ein Versuch, solch ästhetische Bergung zu eliminieren. Ein Staat jedoch muss in ästhetischen Repräsentationen Bergung finden, in Flaggen, Wappen und Hymnen. Einer, der dies klar gesehen hat, war Bertolt Brecht. Im Jahr 1950, kurz nach Gründung der Deutschen Demokratischen Republik, schrieb er seine „Kinderhymne“. Das später von Hanns Eisler vertonte Gedicht spricht die Notwendigkeit der ästhetischen Bergung nicht nur aus, es praktiziert sie.
Anmut sparet nicht noch Mühe
Leidenschaft nicht noch Verstand
Daß ein gutes Deutschland blühe
Wie ein andres gutes Land.
Daß die Völker nicht erbleichen
Wie vor einer Räuberin
Sondern ihre Hände reichen
Uns wie andern Völkern hin.
Und nicht über und nicht unter
Andern Völkern wolln wir sein
Von der See bis zu den Alpen
Von der Oder bis zum Rhein.
Und weil wir dies Land verbessern
Lieben und beschirmen wir’s
Und das liebste mag’s uns scheinen
So wie andern Völkern ihrs.
Ein Aufruf zum Aufbau Deutschlands. Emotionale Verbundenheit mit dem Vaterland geht der Arbeit an ihm nicht voraus, sondern die Liebe resultiert aus dem Engagement. Der Staat, den wir aufbauen und verbessern, muss jedoch auch beschirmt werden. Bevor er jedoch auf andere Weise geschützt werden kann, wird er zuerst einmal ästhetisch geborgen. Die Hymne selbst birgt das gute Deutschland. In der Geborgenheit wächst die Liebe zu ihm.